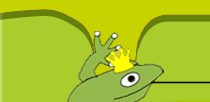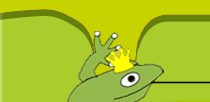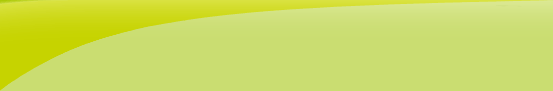Diese Weihnachtsgeschichte ist leider nicht frei erfunden und spielt in den achtziger Jahre im letzten Jahrhundert. Lediglich die Namen sind verändert. Genaugenommen wurde die Pflegerin viermal aus dem Rathaus geräumt, dreimal recht unsanft. Herr Schulz und Herr Meyer sind nicht überzeichnet oder übertrieben dargestellt. Im Gegenteil!
Marzipankartoffeln
Ein Theaterstück in fünf Bildern
Personen: Frau Kowalski, eine alte Dame; Heidrun Dreyer, eine junge Frau und Hauskrankenpflegerin; Herr Schulz, Sachbearbeiter im Sozialamt; Herr Meyer, Amtsleiter des Sozialamtes; Herr Schmidt, Pförtner des Sozialamtes; vier Polizeibeamte, zwei junge und zwei ältere Männer; Frau Becker, Leiterin der Sozialstation; Herr Möller, Rechtsanwalt der Sozialstation, Frau Brand, Reporterin; Herr Salomon, Bürgermeister
1. Bild
Frau Kowalski
Auf der Bühne sieht man eine Tür und ein Zimmer. Zwischen Tür und Zimmer befindet sich der angedeutete und nicht einsehbare Flur. Das Zimmer ist spärlich eingerichtet mit einem runden Tisch, vier Stühlen und einem Vertiko. Über dem Vertiko hängen vier Bilder. Die beiden Zimmerfenster sind mit Decken verhangen. Lichtquelle ist eine Kerze auf dem Tisch. Frau Kowalski sitzt im Mantel mit Schal und Handschuhen am Tisch und liest. Heidrun Dreyer in weißen Jeans und weißem Pullover, darüber lässig einen offenen Anorak, über die Schulter eine große Tasche gehängt, steht vor der Wohnungstür und klingelt mehrmals, wobei sie nach dem ersten Klingeln lauscht, ob es die Klingel überhaupt tut. Nachdem sich nichts rührt, klopft sie mit Nachdruck an der Tür. Die alte Dame erhebt sich vom Stuhl und geht mit schlurrfenden Schritten zur Rückseite der Tür. Sie öffnet und ihr Kopf wird im Türspalt sichtbar.
Heidrun: Pardon! Ihre Klingel scheint kaputt zu sein. Guten Tag! Ich komme von der Sozialstation. Sind sie Frau Kowalski?
Frau Kowalski: Ja, die bin ich.
Heidrun: Mein Name ist Schwester Heidrun. Ich soll ihre Pflege übernehmen.
Frau Kowalski: Ach wissen sie, ich brauche eigentlich keine Pflegerin.
Heidrun: Oh, das wäre mir außerordentlich recht. Aber könnten wir das nicht in ihrer Wohnung klären. Hier im Treppenhaus erscheint mir unser Gespräch mehr als unpassend.
Frau Kowalski: Das ist doch nicht nötig. Da ich keiner Pflege bedarf, können sie ruhig gleich wieder gehen. Ich möchte sie nicht aufhalten.
Die alte Dame macht Anstalten, die Türe wieder zu schließen, unterlässt es aber doch nach Ansprache der Pflegerin und verbleibt im Türspalt.
Heidrun: Moment mal! So einfach verhält es sich auch wieder nicht. Hören sie zu, Frau Kowalski. Ich bin die absolut Letzte, die sich jemanden aufzwängt oder um Arbeit reißt. Seit vierzehn Tagen laufe ich rund. Das städtische Krankenhaus muss irgendetwas gestochen haben. Seit Tagen schmeißen sie sämtliche Patienten heraus, die irgendwie alleine atmen. Um das Sommerloch zu überbrücken und die Bettenkapazität auszulasten, dafür hießen sie die Alten willkommen. Doch nun, kurz vor den Feiertagen, übertrumpfen sie ohne weiteres Lourdes und sämtliche anderen Wunderheilorte weltweit angesichts der erstaunlichen blitzartigen Genesungsrate, nicht unbedingt qualitativ, aber quantitativ auf jeden Fall. Kein Aas interessiert sich dafür, ob die Sozialstationen überhaupt die Vorraussetzungen erfüllen, um eine solche Patientenflut zu meistern. Jammern allerorts die Kliniken über chronischen Personalmangel, leuchtet es ein, dass in unserem wenig anerkannten Job erst recht Notstand herrscht.
Die letzten zwei Wochen begann mein Arbeitstag morgens um vier Uhr. Um vier Uhr, Frau Kowalski. Ich bin aber kein Bäcker, sondern Krankenschwester. Und ich kam die letzten Tage nicht einmal vor zweiundzwanzig Uhr nach Hause. Nicht einmal an den Wochenenden! Frau Kowalski! Ich mache natürlich nicht sie für die Misere verantwortlich, aber eventuell verstehen sie jetzt, dass meine Begeisterung in Grenzen blieb, als die Sozialstation mir auch noch ihre Pflege einbrockte. Wenn sie also die Hauskrankenpflege ablehnen, käme es mir sehr entgegen. Doch dazu müssen noch einige Formalitäten geklärt werden. In diesem Lande läuft nun einmal nichts ohne Bürokratismus. Es wäre nett, wenn sie mich jetzt einfach in ihre Wohnung ließen, um die Angelegenheit abzuwickeln.
Frau Kowalski: Reicht es denn nicht, wenn ich sage, dass ich niemanden beanspruche?
Heidrun: Nein, das reicht nicht. Das Krankenhaus verordnete häusliche Pflege, die ihre Krankenkasse genehmigte. In einem solchen Fall muss ich begründen, warum ich die ärztliche Verordnung nicht umsetzte. Passiert ihnen etwas, werde ich unter Umständen wegen unterlassener Hilfeleistung belangt.
Frau Kowalski: Ich habe denen sofort erklärt, dass ich niemanden benötige.
Heidrun: Na, und warum ordnete man trotzdem ambulante Betreuung an?
Frau Kowalski: Weiß ich nicht. Vielleicht – vielleicht weil ich nicht entlassen werden wollte.
Heidrun: Also fühlen sie sich doch noch nicht so fit?
Frau Kowalski: Doch, doch! Es geht mir glänzend.
Heidrun: Und deshalb wollten sie partout im Krankenhaus bleiben? Alles klar! Irgendwie übersteigt das Ganze mein Fassungsvermögen. Hören sie: normalerweise gelte ich als ein sehr geduldiger Mensch. Und es tut mir aufrichtig leid, dass sie meine momentane Arbeitsüberlastung zu spüren bekommen. Nichtsdestotrotz vertrage ich zur Zeit keine Mätzchen. Händigen sie mir einfach den Entlassungsschein aus, vervollständigen sie fehlende Personalien in meinem Aufnahmebogen und setzen sie eine schriftliche Erklärung betreffs der Ablehnung auf. Schon sind sie von meiner Anwesenheit befreit. Bitte Frau Kowalski, erschweren sie mir doch meine Aufgabe nicht mehr als nötig.
Frau Kowalski: Ich habe...! Ich wollte...! Bei mir ist aber nicht aufgeräumt.
Heidrun: Frau Kowalski, wenn das ihr einziges Problem darstellt, darf ich sie beruhigen. Da bin ich berufswegen Einiges gewöhnt und wenn ich an meine eigene Bude denke, dann gleicht sie gegenwärtig einem wahren Trümmerfeld. Wann sollte ich denn etwas zu Hause erledigen nach einem achtzehnstündigen Arbeitsmarathon?
Frau Kowalski: Sie sind sehr jung für eine Schwester.
Heidrun: Möchten sie meinen Dienstausweis sehen, Frau Kowalski?
Kramt, ohne eine Antwort abzuwarten, in ihrer Tasche und zieht während ihrer Rede schließlich den Ausweis vor.
Eine Sekunde, bitteschön, studieren sie ihn in aller Ruhe, aber wenn möglich, nicht in diesem zugigen Flur. Liebe Frau! Auf mich warten, im Gegensatz zu ihnen sehnsüchtig, heute noch elf Patienten, weil sie ohne Unterstützung nicht aus dem Bett kommen oder sich nicht alleine waschen können oder ihr Verband sollte gewechselt werden bevor er durchsuppt oder sie dürfen ohne die Insulinspritze nicht essen oder Medikamente fehlen oder oder oder. Wenn die Krankenhausärzte weniger unfähig und gedankenverloren nicht ständig auf den letzten Drücker Patienten ohne Medikamente und Verbandszeug heimwärts schickten, wäre ich zu ihnen auch erst zu einem späteren Zeitpunkt gekommen. Gute Frau! Heute ist Freitag. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um irgendwelche Rezepte oder Pillchen zu besorgen. Aber um das festzustellen, müssten sie schon etwas kooperativer sein.
Frau Kowalski: Ich habe nichts verschrieben bekommen.
Heidrun: Wunderbar, Frau Kowalski, wunderbar! Dann bleibt es mir zumindest erspart, noch zu ihrem Arzt und Apotheke loszuhechten. Sicher vermerkte man es auch in ihrem Entlassungsschein? Auf mich machen sie einen recht fidelen Eindruck. Anscheinend können sie also wirklich auf meine Dienste verzichten. Dann lassen sie uns bitte den Schreibkram erledigen und klauen sie mir nicht mit dieser sinnlosen Diskussion hier im eisigen Flur meine kostbare Zeit.
Frau Kowalski: In meiner Wohnung ist es ebenfalls ziemlich kühl.
Heidrun: Ich gehöre zur abgehärteten Sorte.
Frau Kowalski: Also gut, treten sie ein.
Niedergeschlagen wirkend entfernt sie die Kette an der Tür und öffnet sie weit genug, dass die Pflegerin eintreten kann und der Flur erkennbar ist, ein fast völlig dunkler Raum.
Heidrun: Na endlich! Oh, reichlich duster hier.
Noch im Türrahmen tastet die Pflegerin nach einem Lichtschalter, den sie hinter der Tür vermutet.
Wo befindet sich denn der Lichtschalter?
Frau Kowalski: Der funktioniert nicht. Im Zimmer wird es heller.
Die beiden Frauen betreten das Zimmer. Die alte Dame geht voran in Richtung Tisch. Die Pflegerin verharrt zunächst auf der Türschwelle und schaut sich verunsichert um. Vor den Fenstern hängen dicke Decken, die nur am Rande etwas Tageslicht hereinlassen.
Heidrun: Donnerlüttchen! Ihre Wohnung als kühl zu bezeichnen, erscheint angesichts der Realitäten maßlos untertrieben. Eispallast beschreibt passender den Zustand ihrer, ähm, Behausung. Dagegen bot der Hausflur ja noch richtig mollige Temperaturen abgesehen vom Durchzug. Wieso stellen sie die Heizung nicht an?
Frau Kowalski: Ja wissen sie – also – die Heizung? Die Heizung ist gerade defekt.
Heidrun:
wieder nach einem Lichtschalter tastend
Aber doch wohl nicht seit gestern oder wie erklären sie die Decken vor den Fenstern ? Nanu! Der Lichtschalter tut es auch nicht.
Frau Kowalski: Ich hole schnell aus der Küche eine Kerze.
Heidrun: Nicht nötig! Auf dem Tisch steht eine, unübersehbar in dieser Finsternis. Vielleicht fehlt nur eine Sicherung. Wo finde ich denn ihren Stromzähler?
Die alte Dame, die bereits in Richtung Zimmertür unterwegs war, bleibt unvermittelt stehen.
Frau Kowalski: Der Stromzähler, ja der Stromzähler, der Stromzähler?
Heidrun: Sie müssen doch wissen, wo sich der Stromzähler befindet. Frau Kowalski, der schwarze Kasten, wo man Sicherungen austauscht. Die kleinen weißen flaschenförmigen Dinger mit den Metallköpfchen obendrauf. Wollen sie mir weiß machen, dass sie noch nie Sicherungen wechselten?
Frau Kowalski: Doch! Doch! Wo war der nur?
Heidrun: Normalerweise hängt der Sicherungskasten im Flur. Warten sie einen Augenblick, ich sehe nach!
Frau Kowalski: Bleiben sie hier. Ich besitze keinen Stromzähler.
Heidrun: Wie bitte?
Frau Kowalski: Den holte man vor acht Jahren ab.
Heidrun: Wieso abholen? Ja, woher nehmen sie dann Strom, um das Licht anzuknipsen? Stop mal! Worauf kochen sie? Oder haben sie einen Gasherd?
Frau Kowalski: Der Herd? Der Herd?
Heidrun: Oh, Frau Kowalski! Unsere Gespräche empfinde ich als höchst anstrengend, um sie nicht als nervtötend zu bezeichnen. Ich ziehe nicht gerne den Leuten jedes Detail popelartig aus der Nase. Zeigen sie mir bitte die Küche.
Frau Kowalski: Die Küche?
Heidrun: Jetzt reicht es. Ich hasse diese Dragoner von Krankenschwestern, die mir nichts dir nichts einem über den Mund wischen, knüppelhart ihren Willen diktieren und systematisch ihre Mitmenschen entmündigen. Sie jedoch lassen mir gar keine andere Wahl.
Die Pflegerin dreht sich abrupt um und verschwindet im Flur. Die alte Dame bleibt wie erstarrt mitten im Zimmer stehen. Aus der Küche klingt Heidruns Stimme in das Zimmer.
Aha, hier ist also die Küche. Dachte ich es mir doch: ein Gasherd! Nanu – der reagiert ja überhaupt nicht. Meiner Meinung nach verfügen die Geräte am Gasrohr noch über eine zusätzliche Sperre. Nein, der Hahn weist in die richtige Richtung. Frau Kowalski?
Frau Kowalski: Ja!
Heidrun: Wieso kommt kein Gas an?
Frau Kowalski: Jaaa!
Heidrun: Danke für das Gespräch, Frau Kowalski! Na Klasse! Ein Gasherd ohne Gas. Da strömt wenigstens kein Gas versehentlich aus. Man hört ja immer wieder von Gasunfällen. Sehr clever. Sehr sicherheitsbewusst. Und dieser Lichtschalter dient ebenfalls nur dekorativen Zwecken. Das schont immerhin die Glühbirnen. Ah – ein Bad gehört auch zur Wohnung. Liebe Heidrun, die einmalige Chance, göttlich zu fühlen, wenn ein Licht anginge. Siehste, du neigst eben nicht zum Größenwahnsinn. Eih schau einer an: ein Gasdurchlauferhitzer – tot wie Kumpel Herd in der Küche.
Die Pflegerin erscheint wieder in der Zimmertür.
Frau Kowalski, reichen sie mir mal bitte die Kerze.
Dabei zeigt sie auf die Kerze auf dem Tisch. Frau Kowalski geht robotermäßig zum Tisch und holt die Kerze mit Kerzenleuchter und gibt sie der Pflegerin. Langsam bewegt sie sich wieder in Richtung Tisch. Heidrun leuchtet mit der Kerze den Flur aus und öffnet direkt hinter der Zimmertür eine Tapetentür.
Meine Güte! Bei ihnen entwickel ich richtige Sherlock-Holmes-Fähigkeiten: auf Anhieb der Sicherungskasten! Sogar mit Sicherungen, allerdings dummerweise ohne Zähler! Na bitte! Und darunter enden zwei verträumte Gasrohre im Nichts. Wirken ein wenig sinnlos so ganz ohne Anschluss. Diese Wohnung stürmt förmlich auf den Gipfel des vollendeten, reinsten Nihilismus. Ach nein! Hätte das noch Herr Nietzsche erleben dürfen. Jubeln würde er, jubeln. Träume ich oder wache ich?
Die Pflegerin kehrt ins Wohnzimmer zurück.
Frau Kowalski, vor wieviel Jahren sagten sie, wurde der Stromzähler abmontiert?
Frau Kowalski: Vor acht Jahren!
Heidrun: Und seitdem hausen sie ohne Elektrizität, ohne warmes Wasser, ohne Heizmöglichkeit? Sie dürfen mich getrost berichtigen, falls mein Resümee nicht zutrifft.
Frau Kowalski: Auf die Heizung verzichtete ich schon früher.
Heidrun: Wie waschen sie sich eigentlich?
Frau Kowalski: Man gewöhnt sich an das kalte Wasser.
Heidrun: Brr! Na großartig! Allein bei dem Gedanken beschleicht mich eine Gänsehaut. Und wie kochen sie? Oder bevorzugen sie Rohkost?
Frau Kowalski: Nein! Mein kleiner Campingkocher reicht zum Garen meiner Mahlzeiten völlig aus.
Heidrun: Da freuen wir uns aber. Liebe Frau Kowalski, sie spaßen mit mir, sie meinen es nicht Ernst? So etwas habe ich noch nie erlebt. Frau Kowalski, wir schreiben das Jahr 1973. Wieso kokettieren sie mit der Steinzeit? Warum verzichten sie auf Strom und Gas? Bei aller Sparsamkeit, aber das geht wohl etwas zu weit. Das letzte Hemd besitzt keine Taschen.
Frau Kowalski: Die Taschen würden mir auch wenig nützen. Mir fehlen einfach die finanziellen Mittel, um das Alles zu bezahlen. Ich weiß, auf was sie hinaus wollen. Ich leide nicht an dem, was man Altersgeiz nennt.
Heidrun: Ich will ihnen beileibe nicht zu nahe treten, aber um Himmels Willen, was machen sie mit ihrem Geld? Saufen sie? Pokern sie? Füttern sie einarmige Banditen? Schnuppern sie heimlich Kokain? Stecken sie es ihren Kindern zu?
Frau Kowalski: Friedrich und ich hatten keine Kinder.
Die alte Dame ist völlig aufgelöst und den Tränen nahe.
Ich wusste gleich, dass es mir nur Schwierigkeiten bereitet, wenn irgendjemand hierher kommt. Darum flehte ich den Doktor regelrecht an, mir nicht eine Hilfe zuzuweisen.
Mit Bestürzung registriert Heidrun, dass die Frau die Fassung verliert. Sie geht zu ihr hin, nimmt sie in den Arm und bringt sie zu einem Stuhl an den Tisch.
Heidrun: Frau Kowalski! Bitte! Regen sie sich nicht auf. Verstehen sie nicht, dass das hier alles sonderbar und mysteriös anmutet. Frau Kowalski, versuchen sie mal, es mir so zu erklären, dass ich Schmalspurhirn es auch begreife. Bekommen sie eine Rente?
Frau Kowalski: Ja, aber die reicht nicht.
Heidrun: Wieviel Rente erhalten sie? Entschuldigung, es geht mich nichts an. Ihre finanzielle Situation dürfte mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Und die Frage ist zugegebenermaßen indiskret. Aber langsam gewinne ich den Eindruck, dass niemand mehr Hilfe braucht als sie.
Frau Kowalski: Zweihundertvierzig Mark bekomme ich pro Monat.
Heidrun: Wie bitte? Zweihundertvierzig Mark? Damit überleben sie einen ganzen Monat? Das kann ich nicht glauben.
Frau Kowalski: Im Vertiko steht mein Aktenordner. Ich kann es ihnen beweisen.
Heidrun: Könnten wir mal wenigstens eine Decke zur Seite schieben? In diesem funzligen Licht verdirbt man sich glatt beim Lesen die Augen.
Die alte Dame nickt und die Pflegekraft läuft zum Fenster, schiebt eine Decke beiseite und klemmt sie im Fenstergriff fest. Gleißendes Tageslicht dringt in die Stube und erhellt etwas mehr den Raum. Zwischenzeitlich sucht Frau Kowalski den Aktenordner heraus und legt ihn offen auf den Tisch, zu dem Heidrun tritt. Beide Frauen setzen sich und die Pflegerin beginnt in dem Ordner zu blättern und zu lesen.
So! Rentenbescheid, Kontoauszüge, Mietquittungen! Sie zahlen zweihundertvier Mark Miete? Wenn mich Adam Riese nicht im Stich läßt, verbleiben ihnen somit ganze sechsunddreißig Mark für Wohnnebenkosten, Kleidung und Ernährung. Für diese Summe kriege ich nicht einmal meinen Köter gefüttert. Frau Kowalski, binden sie mir gerade einen Bären auf? Das können niemals ihre gesamten Einkünfte sein. Bei dieser niedrigen Rente müssten sie doch zusätzlich Sozialhilfe beziehen. Oder beantragten sie diese Leistungen nicht?
Frau Kowalski: Doch! Vor einigen Jahren suchte ich das Sozialamt auf, weil mir eine Bekannte sagte, dass mir Hilfe zustünde. Ich treffe die Dame immer auf dem Friedhof. Ihr Wilhelm liegt direkt neben Friedrich. Manchmal geraten wir ins Plaudern. Die schickte mich zum Amt. Wann war denn das? Ich stellte Friedrich vier Grablichter auf das Grab. Genau! Vor fünf Jahren wagte ich mich zum Rathaus. Mir ging es schlecht und ich wusste nicht mehr ein und aus.
Heidrun: Ja und? Seitdem erhalten sie Unterstützung?
Frau Kowalski: Nein! Der Mann, dem ich mein Anliegen vortrug, legte dar, dass niemand dafür könne, wenn wir nicht ausreichend gearbeitet hätten. Darauf erwiderte ich diesem Herrn Schulz, Schulz hieß er, dass mein Friedrich Kunstmaler war und nie auf der faulen Haut lag. Auch freischaffende Künstler klebten für die Altersvorsorge, meinte er, und nun solle die Gesellschaft für unsere Versäumnisse haften. Wenn wir schon keine Beiträge zur Rente abführten, verstünde er es nicht, wieso wir uns nicht rechtzeitig absicherten und für den Ruhestand sparten. Ach, ich versank vor Scham fast in den Erdboden. Ich fühlte mich wie der letzte Schmarotzer, der um Bakschisch bettelnd anständige Menschen belästigt. Bitte, Schwester Heidrun, glauben sie mir, wir faulenzten nicht und spielten auch nicht Bruder Leichtfuß. Vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten besaßen wir geregelte Einkünfte, weil Friedrich als Kunsterzieher eine gutdotierte Stellung bekleidete. Daneben malte er bis in die Nacht und seine Bilder fanden großen Anklang und verkauften sich bestens. Wir schafften es bald zu einem gewissen Wohlstand. Nie dachte mein Friedrich damals daran, wie es kommen könnte oder wie er mich eines Tages hinterlässt.
Heidrun: Na – und wodurch sind sie in dann in eine solch krasse Armut geschlittert?
Frau Kowalski: Als die Nazis kamen verlor mein Mann seine Anstellung und seine Bilder wollte angeblich plötzlich niemand mehr haben. Der braune Mob bezeichnete sie als entartete Kunst. Im Grunde genommen verhielten wir uns stets unpolitisch. Aber diese Braunhemden, die mochte mein Friedrich nicht. Er hielt nie mit seiner Meinung hinter dem Berg. Ich witterte die Gefahr und warnte ihn oft genug, etwas vorsichtiger seine Ansichten kundzutun. Schweigen heißt zustimmen, pflegte er zu antworten.
Zweimal büßte er für seine Unvorsichtigkeiten kurz hintereinander in der sogenannten Schutzhaft. Nach der zweiten Inhaftierung entließen die Schergen ihn mit gebrochenen Fingern. Alle fünf Finger der rechten Hand gebrochen. Eine Katastrophe für einen Maler. Die Finger verheilten, dem Himmel sei Dank, relativ schnell und komplikationslos. Aber die seelischen Wunden hinterließen immer gewaltigere Narben.
Viele Freunde wanderten aus oder flüchteten, andere ehemalige Weggenossen mieden uns, manche kannten uns nicht einmal mehr. Mein Friedrich war sehr sensibel. Er versank fast in seiner Trauer über die verlorenen Freunde, über die falschen Freunde, über das Stiefelgetrampel der Nazihorden auf den Straßen und über die Gewalt, die man unserem Land antat. In solcher Atmosphäre gelang es ihm nicht mehr, den Pinsel in die Hand zu nehmen.
Aber es war doch das Einzige, was er gelernt hatte, sein gesamter Lebensmittelpunkt. Ich fürchtete, dass er früher oder später völlig zerbricht. So überzeugte ich ihn schließlich, Deutschland den Rücken zu kehren, bis dieser Nazispuk vorbei sei. Wir zogen von Berlin nach Prag, von Prag nach Bukarest, von Bukarest nach Tunis, von Tunis nach Sao Paulo und als wir nach Berlin zurückkehrten, besaßen wir nur noch das, was wir auf dem Leibe trugen.
Heidrun: Aber erhielten sie denn keine Wiedergutmachung?
Frau Kowalski: Ha! Wir waren doch in dem Sinne keine Verfolgten des Naziregimes. Angeblich bestand keine Gefahr für unser Leben. Im NS-Wahnsinn zu traurig zum Malen zu sein reicht nicht als Begründung. Viele Maler unternehmen Bildungsreisen, vielleicht gedachten wir lediglich unsere Flitterwochen nachzuholen, die wir so genossen, dass wir sie auf fast sieben Jahre ausdehnten? Wir verloren restlos alles: unsere schmucke kleine Villa mit dem riesigen herrlichen Garten in Falkensee, Mobiliar, das Charlottenburger Atelier, Hunderte von Bildern, persönliche Erinnerungen, sämtliche Haushaltsgegenstände. In zwei Koffer passt halt nicht viel hinein. Nein! Die Nationalsozialisten enteigneten uns nicht, sondern nahmen sich mitleidsvoll unserer vorsätzlich bösartig verlassenen und verwaisten Sachen an. Die Beiträge für die Künstlerkasse waren futsch. Irgendwie beschlich uns das deutliche Gefühl, etwas verkehrt zu machen angesichts der ehemaligen Kollegen von Friedrich, die großzügigst entschädigt wurden für verlorenes Eigentum, dass ihnen nie gehörte. Mädchen, was meinst du, oh, Entschuldigung, natürlich sie......
Heidrun: Ist schon in Ordnung. Die Mehrzahl meiner Patienten duzen mich. Damit habe ich kein Problem. Reden sie nur weiter.
Frau Kowalski: Sie können sich nicht vorstellen, wieviele Künstler sich mit den braunen Machthabern arrangierten.
Heidrun: Leider reicht meine Vorstellungskraft hierfür aus. Aber 1945 bekämpften alle urplötzlich von der ersten Sekunde an die Diktatur als entschiedene Widerstandskämpfer. Keiner schrie je „Heil“ und niemand wählte Adolf Schicklgruber.
Frau Kowalski: Sie treffen den Nagel haarscharf auf den Kopf. Bevor wir Deutschland verließen, zeigten manche Mitbürger noch so etwas wie klammheimliche Solidarität. Nach Ladenschluss kauften Galeristen zu fairen Preisen Gemälde meines Gatten an. In unserem Lieblingslokal servierte der Wirt zu unserem Erstaunen uns häufig einen Schoppen Wein. Sein Blick in Richtung des Gönners verriet, wer uns diesen spendierte, sodass unsere Augen sich unauffällig bei demjenigen bedanken konnten. Oder zum Weihnachtsfest trafen gleich mehrere anonyme Päckchen mit Marzipankartoffeln ein.
Ich liebte seit frühester Kindheit Marzipankartoffeln und für mich gehören sie einfach zum Fest. Sogar in Tunis erreichte uns Weihnachten ein Päckchen. Alleine ihr Duft versetzte mich in die Heimat, in meine Kindheit mit Weihnachtsbaum und Schlittengeläute, mit Unbekümmertheit und Lachen, mit Vorfreude und Behaglichkeit. Auch wenn die Marzipankartoffeln die lange Reise nicht unbeschadet überstanden, sie schmälerten erheblich das weihnachtliche Heimweh bei dreißig Grad im Schatten statt Schneegestöber und Palmen statt Tannen.
In der Fremde vereinsamten wir weniger als nach unserer Rückkehr nach Deutschland. Der frisch eingesetzte Gesinnungswandel unserer Mitmenschen half uns kaum, eher schadete er uns. Man reagierte auf uns noch ablehnender als zu Adolfs Zeiten. Wissen sie, für die Einen stellten wir so etwas wie ihr schlechtes Gewissen dar. Sie dachten wie wir, aber zogen keine Konsequenzen. Unsere Anwesenheit erinnerte sie heftig an ihre jahrelange Stummheit, an ihr Mitläufertum, an ihr Mitmachen gegen besseren Wissens. Nie verlangten wir Rechenschaft, nie äußerten wir Kritik, nie formulierten wir den geringsten Vorwurf – aber sie wichen uns aus. Wer lässt sich schon gerne mit der eigenen Unzulänglichkeit konfrontieren?
Die Anderen zitterten davor, dass wir ihr Lügengespinste entlarven und ihre Machenschaften für die Nationalsozialisten anprangern könnten. Viel stand für sie auf dem Spiel: ihre Glaubwürdigkeit, die inzwischen errungene Position, die gesellschaftliche und häufig auch private Anerkennung. Unsere Isolation vertiefte sich fast noch schlimmer und umfassender wie vor unserer Flucht. Es gab keinen Menschen, der für uns aussagte, der unsere Erklärungen bezeugte. Nachweise für Friedrichs Inhaftierungen fehlten, obwohl soviele davon wussten.
Heidrun: Ein hartes Los! Darf ich rauchen?
Frau Kowalski: Bitteschön! Mich stört es nicht. Friedrich rauchte auch, aber Pfeife. Ich hole dir einen Aschenbecher.
Während sie zum Vertiko geht und einen Aschenbecher holt, berichtet sie weiter:
Wir bereuten bitterlich, zurückgekehrt zu sein. In Brasilien veräußerten wir unsere letzte Habe für die Heimreise. So blieb gar nichts anderes übrig, hier wieder Fuß zu fassen. Ohne einen Pfennig, ganz von vorne fingen wir an. Die ersten Jahre nach dem Krieg plagte die Menschen völlig andere Sorgen, als sich mit Malerei zu beschäftigen. Als Garderobiere im Kino, als Putzhilfe, als Toilettenfrau im Nachtklub versuchte ich jahrelang, unsere kläglichen Einnahmen aufzubessern. Fast täglich drückte ich Klinken, um irgendwelchen kleinen Galerien oder Glasern die Kunstwerke meines Mannes aufzuschwatzen.
Manchesmal erwarben sie grobschlächtige Menschen ohne jeglichen Kunstverstand weit unter ihrem Wert. Das tat weh. Wir lebten wahrhaftig von der Hand in den Mund. Nach einigen Jahren schien es fast so, als gelänge es uns, die Talsohle zu durchqueren. Aber Friedrich? Mein Friedrich verkraftete auf Dauer nicht die langjährigen Entbehrungen und Demütigungen. Er litt darunter, dass Berufskollegen uns absonderten, als seien wir ein stinkender, eitriger Pickel, den es auszuquetschen galt. Friedrichs Augen verloren ihren Glanz und 1964 streikte sein Herz.
Heidrun: Dem Mann auf dem Sozialamt erzählten sie auch ihre Geschichte?
Frau Kowalski: Ich versuchte es ihm darzustellen.
Heidrun: Mmh! Und dieser Herr...?
Frau Kowalski: Schulz! Herr Schulz! Ein kleiner, dicker Mann mit schmierigen Wesen und feistem Gesicht. Ein fürchterlicher Mensch, dem ich mich da auslieferte. Keine Bildung, kein Benehmen und derart gewöhnlich! In dem Nachtklub, in dem ich die Toiletten reinigte, verkehrten viele Männer dieser Sorte. Nein! Und so ein Mensch erniedrigt mich bis zum Letzten. So einer durfte das Andenken meines Mannes beschmutzen. Lieber verhungern als diese Demütigung ertragen.
Heidrun: Dieser Herr Schulz begriff, dass sie von ganzen sechsunddreißig Mark im Monat existieren?
Frau Kowalski: Na, ich besitze doch nicht mehr Geld. Anfangs veräußerte ich noch Bilder meines verstorbenen Mannes. Inzwischen hängen hier nur noch vier Bilder von ihm. Es mag nicht richtig sein, aber ich kann mich nicht von ihnen trennen.
Heidrun: Halten sie doch mal bitte die Decke am Fenster weiter zurück.
Die alte Dame folgt dem Wunsch und hebt am Fenster die Decke weit in die Höhe. Das Tageslicht erhellt den Raum. Inzwischen nähert sich die Pflegekraft den Bildern an der Wand und betrachtet sie eingehend.
Dankesehr! Schöne Bilder, sehr ausdrucksstark, handwerklich ausgefeilt, ein imponierender Stil. Mein Stiefvater ist ebenfalls Kunstmaler. Ich möchte nicht prahlen, aber ein wenig schulte er mein Auge und Urteilskraft. Die Gemälde fielen mir übrigens trotz des Dämmerlichtes gleich beim Betreten des Zimmers auf. Frau Kowalski! Natürlich behalten sie diese Bilder. Niemand darf sie zwingen, diese wegzugeben. Allerdings muss sich ihre Lebenssituation schleunigst ändern. Wie ernähren sie sich überhaupt bei ihrer finanziellen Lage?
Nachdem sich Heidrun wieder abwendet und zum Tisch zurückkehrt, lässt auch Frau Kowalski die Decke sinken und setzt sich wieder auf ihren Stuhl.
Frau Kowalski: Ich kaufe mir jede Woche eine Tüte Kartoffeln. Die teile ich mir ein.
Heidrun: Was? Sie leben ausschließlich von Kartoffeln?
Frau Kowalski: Für mehr reicht es nicht. Ab und zu leiste ich mir eine Kartusche für den Campingkocher und Kerzen und hin und wieder ein bisschen Tee. Oh, darf ich dir, äh, ihnen, eine Tasse Tee anbieten?
Heidrun: Nein danke! Ich bevorzuge Kaffee und mit dem kippen mich meine Patienten tagtäglich bis zum Anschlag zu. Sehr lieb gemeint, aber Tee trinke ich lediglich im Krankheitsfalle.
Frau Kowalski: Kaffee habe ich leider nicht da.
Heidrun: Das macht nichts, Frau Kowalski, dass schont meinen Magen. Der Herr Schulz! Kam er damals zu ihnen zum Hausbesuch?
Frau Kowalski: Nein!
Heidrun: So überprüfte er nie ihre Angaben? Auch nicht im Nachhinein?
Frau Kowalski: Nein! Ich erfuhr doch sofort von ihm, dass für mich keine staatlichen Unterstützungen greifen.
Heidrun: Wieso wehrten sie sich gegen die Entlassung aus dem Krankenhaus?
Frau Kowalski: Ich hoffte inständig, wenigstens noch über die Feiertage dableiben zu dürfen. Alles ducken, um keinen Preis auffallen, nutzte nichts. Zugegeben, der Klinikalltag verfügt über viele Schattenseiten: um sechs Uhr wecken für Fieber messen und Betten machen und das mir, wo ich gerne ausschlafe. Drei verhuschte alte Damen lagen mit mir im Zimmer und strapazierten mächtig meine Nerven und dem Personal mangelte es meist an Zeit für eine kleine Unterhaltung. Manchmal ertappte ich mich dabei, etwas neidvoll auf die Mitpatienten zu äugen, die regelmäßig Besuch bekamen. Inmitten der vielen Menschen auf der Station fühlte ich mich mehr allein wie daheim. Aber warm war es dort und es gab im Überfluss zu essen.
Heidrun: Also grundsätzlich entsprach es schon ihrem Wunsch, nach Hause zu kommen. Nur nicht zu diesem Augenblick?
Frau Kowalski: Um Himmels Willen! Ich durchschaue, was sie andeuten. Nein, in ein Altersheim kriegen mich keine zehn Pferde. Ich fühle mich hier heimisch. Auch, wenn vieles nicht so ist, wie es sein müsste.
Heidrun: Das akzeptiere ich, Frau Kowalski! Das Krankenhaus beschäftigt eine Sozialarbeiterin. Berichteten sie ihr nicht ihre Nöte?
Frau Kowalski: Von einer Sozialarbeiterin weiß ich nichts.
Die Pflegerin zieht einen Brief aus den Papieren auf dem Tisch heraus und öffnet ihn.
Heidrun: So, was sagt denn der Entlassungsschein. Manische Depressionen? Wie entstand denn diese Diagnose?
Frau Kowalski: Der Sommer war heiß und stickig, mein leerer Magen rebellierte und plötzlich fiel ich um. Einfach so. Im Krankenhaus kam ich wieder zu mir. Als ich aus den Latschen kippte und man mich ins Krankenhaus einlieferte, suchten sie angestrengt nach der Ursache. Meine Unterernährung schob ich darauf, dass mir der Appetit fehle seit dem Verlust meines Mannes. Sollte ich etwa zugeben, dass ich nicht genug zu essen habe? Deswegen hieß es, ich sei schwermütig. Aber die Tropfen, die schluckte ich nicht. Wer weiß, was die im Oberstübchen anrichten. Schließlich bestimmten sie einfach, dass eine Pflegerin mich daheim betreuen müsste, damit ich nicht weiter meinen trüben Gedanken nachhänge. Mein Gott, war das unangenehm. Was würde so eine Schwester über mich und meine Wohnung denken?
Heidrun: Dass es mit Strom, Heizung und Gas eine sehr hübsche Wohnung sein könnte, Frau Kowalski. Dass sie sehr tapfer ihr Leben meistern. Und dass das, Verzeihung, deutsch und deutlich gesagt, Arschloch vom Sozialamt sie unrechtmäßig abwimmelte. Anders kann man es nicht ausdrücken und für irgendwelche höflichen Umschreibungen fehlt jetzt die Zeit. Es ist jetzt elf Uhr. Und es ist Freitag. Freitag vor Weihnachten. Nun brennt jede Minute auf den Nägeln. Geben sie mir den Kladderatsch mit, ich melde mich heute nachmittag bei ihnen.
Damit sammelt die Pflegerin die Unterlagen auf dem Tisch zusammen, klappt den Aktenordner zu und verstaut alles in ihrer Tasche.
Frau Kowalski: Aber sie können doch nicht meine Unterlagen mitnehmen?
Schnell verläßt Heidrun das Zimmer und die Wohnung. Im Laufen ruft sie zurück:
Heidrun: Ich bringe sie ihnen zurück. Versprochen! Bis bald.
Frau Kowalski erhebt sich umständlich vom Stuhl und geht zu den Bildern ihres Mannes.
Frau Kowalski: Mein Gott Friedrich! War es richtig, ihr alles zu erzählen? Nun nimmt sie einfach die Dokumente mit. So eine junge Schwester, fast noch ein Mädchen. Was hat sie vor? Ach wärst du doch bloß da. Gemeinsam bekämen wir vieles in den Griff.
- Vorhang! -

2. Bild
Im Sozialamt
Der Vorhang öffnet sich und die Bühne zeigt eine typische Behördenstube der siebziger Jahre: Ein großer Schreibtisch dominiert den Raum, dahinter ein bequemer Schreibtischstuhl für den Beschäftigten. Vor und seitlich des Schreibtisches steht je ein einfacher, unbequemer Stuhl für Besucher, sonst könnten sie zu lange bleiben. Die Wände sind weiß, ein Poster von Picasso, Dali oder Chagall hängt an einer Wand, um Intellekt, Extravaganz oder Kunstverstand des Büroinhabers zu demonstrieren. Das Poster ist gerahmt, schließlich besitzt man Kultur und gediegenen Wohlstand. Direkt daneben kleben Kitschurlaubskarten der Kollegen, Verwandten, Bekannten, notfalls auch selbstgeschriebene, als Zeugnis der Beliebtheit. Auf der linken Ecke des Schreibtisches Akten, akurat Kante auf Kante hochgestapelt, Unordnung und intensiven Arbeitseinsatz vortäuschend, obwohl der Bearbeiter Rechtshändler ist. Deshalb auch rechts das Telefon, wichtigstes Instrument, um anstrengende Gespräche mit dem Klientel höflichst abzuwürgen. Penibel chaotisch verstreute Notizzettel beweisen Überbeanspruchung nach dem Motto: wichtig der, der gefragt ist, weil er Termine hat. Auf dem Fensterbrett stehen zur Verschönerung des Zimmers, denn man ist bürgernah, Grünpflanzen: Man fühlt ökologisch, ist Naturliebhaber, auch romantisch und deshalb kurzum ein liebenswerter Mitmensch. Die Pflanzen beeindrucken durch üppigen Wachstum, symbolisieren damit Verantwortungsgefühl und Sensibilität des Büromenschen, stets Augen für stumme, hilflose Kreaturen zu besitzen. Die Angsttriebe, falls die depperte barmherzige Putzfrau im Urlaub ist, werden zuverlässig weggeschnitten. Herr Schulz, bürgerlich mit Anzug gekleidet, vertieft in einer Akte, sitzt hinter dem Schreibtisch und blökt näselnd gewichtig durch die angelehnte Tür auf den Flur.
Herr Schulz: Der Nächste!
Heidrun betritt das Zimmer. Schulz blickt nicht auf.
Heidrun: Guten Tag!
Nachdem ihr kein Stuhl angeboten wird, sieht sie sich kurz um und setzt sich auf den Holzstuhl neben dem Schreibtisch. Schulz blättert weiter in der Akte.
Herr Schulz: Mmmh!
Heidrun: Guten Tag!
Sie stellt die Tasche neben sich auf den Boden und zieht den Aktenordner von Frau Kowalski heraus. Noch immer würdigt Schulz sie keines Blickes.
Herr Schulz: Was wollen sie?
Heidrun: Einen recht schönen guten Tag! Ich möchte für eine alte Dame Sozialhilfe und ein sofortiges Überbrückungsgeld beantragen. Ich habe sämtliche Unterlagen, Bescheide und Belege dabei.
Herr Schulz: Geht nicht! Muss selber kommen!
Heidrun: Der Gesundheitszustand der Frau erlaubt noch keinen Amtsbesuch. Ich bin ihre Hauskrankenpflegerin von der hiesigen Sozialstation. Bitte, hier ist mein Dienstausweis. Meine Patientin verließ erst heute morgen das Krankenhaus.
Heidrun zieht ihren Ausweis aus der Tasche und hält ihn dem Mann hin. Da das Wort ´Dienstausweis´ immer großen Eindruck macht, unterbricht Schulz das erste Mal sein Aktenstudium und betrachtet neugierig die Besucherin.
Herr Schulz: Na, da machen sie ja auch keinen leichten Job.
Heidrun: Ich kann mich nicht beklagen. Eine abwechslungsreiche Beschäftigung, ständig lernt man neue interessante Leute kennen, bleibt in Bewegung, genießt zwischendurch die frische Luft – im Allgemeinen gefällt mir meine Arbeitsstelle recht gut. Sie steckt den Ausweis wieder ein.
So manchem Kranken erspart meine Tätigkeit einen Krankenhausaufenthalt oder verkürzt zumindest die Verweildauer in der Klinik. Viele alte Menschen, die ich betreue, bliebe ohne ambulante Dienste nur der Weg in ein Pflegeheim. Mit der Folge, alles aufzugeben, was sie sich in ihrem langen Leben mühevoll aufbauten. Unter Umständen geraten sie in eine Einrichtung, in der sie fremdbestimmt, verwaltet, aufbewahrt dumpf vor sich hin siechen und den Steuerzahler viel Geld kosten.
Mit meiner oftmals nur geringen Unterstützung bewahren sie ihre Selbstständigkeit und ihre Daseinsfreude. Die alte Dame, für die ich hier sitze, meistert ebenfalls ihr Leben und ihren Alltag sehr souverän. Ihr mangelt es jedoch an jeglicher materieller Grundlage, um das auch für die Zukunft zu sichern.
Herr Schulz: Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als selber einen Antrag zu stellen.
Heidrun: Vor einigen Jahren versuchte sie es bereits persönlich, jedoch nahm man ihren Antrag nicht einmal auf.
Herr Schulz: Dann stand ihr nichts zu.
Heidrun: Doch! Doch, mein Herr! Denn ihre finanzielle Situation entsprach der heutigen und die ist denkbar katastrophal. Deshalb vegetiert die Frau seit Jahren in ihrer Wohnung ohne Elektrizität und ohne Heizung. Sie verfügt nach Abzug der Mietkosten gerade mal über sechsunddreißig Mark monatlich, um den kompletten Lebensunterhalt zu bestreiten.
Die Pflegerin nimmt den Aktenordner, den sie auf dem Schoß hält, hoch und reicht ihn Schulz, der ihn jedoch ignoriert.
Herr Schulz: In diesem Falle bekäme sie laufende Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz.
Heidrun: Bis jetzt erhält sie gar nichts.
Herr Schulz: So vergaß sie es zu beantragen.
Heidrun: Ich bemerkte eben, dass sie sich genau vor fünf Jahren darum bemühte.
Herr Schulz: Eine Ablehnung des Antrages erfolgt nicht grundlos. Dann verfügt sie nämlich über mehr Einkünfte. Möglicherweise bunkert sie irgendwo Ersparnisse, die die Freigrenze überschreiten. Manchmal wissen die Alten ja gar nicht mehr, wo sie überall ihre Groschen horten. Dolle Dinger erlebten wir schon mit denen, dolle Dinger. Da kneifen die den Arsch zu und das alte verdreckte Kissen landet nur deshalb nicht in den Müllcontainer, weil ein besonders aufmerksamer Mitbürger bemerkt, dass es beim Anfassen so eigenartig knistert. Hah! Fräulein! In ihren kühnsten Träumen kämen sie niemals darauf, was sich im Kissen befand.
Heidrun: Eine Millionzweiundzwanzigtausendundachthundertvierzig Mark und dreihundertsiebzig Dollar.
Herr Schulz: Hoppla! Woher wissen sie?
Heidrun: Weil ich dieser überaus aufmerksame Zeitgenosse war und das Geld zählte. Bevor ich zur Sozialstation wechselte, beschäftigte mich das Pflegeheim, in dem Frau Kuno ihre letzten Jahre verbrachte und sie starb in meiner Spätdienstschicht. Die alte Dame wusste sehr wohl, aus was die Kissenfüllung bestand, denn sie ließ es zu Lebzeiten nicht für den Bruchteil einer Sekunde aus den Augen. Ihre These stimmt also keineswegs vom versteckten Geld, dass in Vergessenheit geriet. Da wir Frau Kuno kannten und wussten, wie sie sich um ihr Kissen sorgte, verständigten wir ganz zielgerichtet die Polizei nach ihrem Tode und trennten es erst in Anwesenheit der Beamten auf, um gar nicht in den Verdacht zu geraten, vielleicht selber zuzulangen. Dieser Geldfund war kein Zufall.
Herr Schulz: Hallelujah. So eine Chance bietet sich nur einmal und die ergreift ihr nicht? Nach dem Teilen mit Mitwissern verbliebe immer noch ein erklecklicher Batzen Knete, eine stolze Mitgift, Schwesterlein, die mit Sicherheit die übertrifft, die ihnen ihre Eltern gewähren. Und was niemand vermisst, danach fahndet auch keiner.
Heidrun: Heiße Tips von einem Staatsdiener.
Herr Schulz: Hah! Bei Vater Staat arbeiten doch nicht nur Deppen. Sie ahnen ja nicht, mit welchen Mitteln die sich den Reichtum verschaffte.
Heidrun: Nein! Ich ahne es nicht, denn ich weiß es.
Herr Schulz: Das schlug doch endgültig dem Faß den Boden aus. Unerhört! Auf dem Kudamm bettelte sich die Olle den Zaster zusammen, tat auf Hungerleider und bettete gleichzeitig ihren verlausten Schädel auf einer Million Mark. Da fiele mir aber allenthalben etwas Besseres ein, als weiterhin bei Wind und Wetter auf der Straße zerlumpt die Leute nach Almosen anzuhauen. Und für diese Tussi berappten wir jahrelang die Pflegeheimkosten.
Heidrun: Frau Kuno galt als sehr reinlich, trotz der erbärmlichen Kleidung. Meines Wissens nach litt sie nicht unter Läusen. Außerdem entsprach die Einweisung in ein Pflegeheim nicht ihrem Willen. Die liebenswerte, zugegeben leicht verschrobene, alte Dame schadete niemanden, höchstens sich selbst.
Herr Schulz: Na ich bitte sie. Die schwamm in der Knete und zockte das Sozialamt voll ab. Und sie behaupten ernstlich, diese Kakerlake haute niemanden übers Ohr? Liebes Kind!
Heidrun: Soweit ich informiert bin, existierten keine Erben. Damit fiel Frau Kunos gesamtes Vermögen dem Staat zu. Mithin beglich sie überaus großzügig sämtliche Kosten, die sie je verursachte. Zeit ihres Lebens knauserte sie mit jedem Pfennig, gönnte sich nie etwas, blieb immer bescheiden und genügsam, stellte keinerlei Ansprüche. Der Frau Kuno eine wissentliche, kalkulierte Bereicherung zu unterstellen, stufe ich als bösartige Verleumdung ein. Sie krankte an Geiz, handelte zwangshaft und litt darunter. Es ließ sich nicht ergründen, welche Lebensumstände oder Erfahrungen diese Symptome auslösten, dessenungeachtet schätzten wir überaus diese umgängliche, liebenswerte und fröhliche Person, möglicherweise genau wegen ihrer Schrullen. Sie zauberte Farbe in den tristen Heimalltag.
Herr Schulz: Nichtdestoweniger beweist es, dass viele dieser verkalkten Mumien, die jammernd und heulend auf diesem Stuhle Platz nehmen, mehr als nur ihre Mottenkugeln fressen.
Heidrun: Die Frau, wegen der ich sie aufsuche, besitzt keinerlei Ersparnisse und empfängt keine weiteren finanziellen Zuwendungen außer zweihundertvierzig Mark Rente bei zweihundertvier Mark Miete. Sie hungert! Sie friert! Sie lebt nicht! Sie vegetiert!
Wieder bietet ihm die Pflegerin den Aktenordner an und wieder negiert er diesen.
Herr Schulz: Liebe Schwester, machen wir uns doch nichts vor. Angenommen, es verhält sich so, wie sie behaupten, wäre die Alte bereits vor die Hunde gegangen, krepiert, abgenippelt. Vor zwanzig Jahren genügten einem Alleinstehenden sechunddreißig Mark als knapp bemessenes Haushaltsgeld. Da kosteten allerdings die Grundnahrungsmittel entsprechend weniger. Aber heute, beste Dame, kann niemand mehr mit einer solchen Summe überleben. Also fließen da irgendwelche dunklen Quellen. Ach, ich kenne meine Pappenheimer. Mir macht keiner was vor. Diese asoziale Brut, diese stinkenden Humanpestizide, dieses arbeitsscheue Gesocks, dieses Sputum der Menschheit! Was hier täglich für Kreaturen einfallen, wimmernd, klagend, auf die Tränendrüse drückend und nach dem Absahnen steigen diese Galgenvögel in ihren Rolls-Royce, manierliche Bürger verhöhnend, sich Ausschweifungen hingebend, ihre Orgien auf Staatskosten feiernd.
Heidrun: Ja, ja! Nun sind ja in Berlin auch soviele Rolls-Royce zugelassen.
Herr Schulz: Ach Schwesterchen! Wir wissen doch, wie ich es meine. Mein Verständnis besitzen sie. Sie sind von ihrer Aufgabe beseelt, Menschen zu helfen, Seelen zu retten. Das ehrt sie. Aber dabei verliert man schon leicht den Blick auf das Reale. Lassen sie sich doch nicht von so einer alten Schlunze vor den Karren spannen. Das sind die Richtigen. Leisteten nie etwas, lutschten stets den Kleister von den Wänden, unfähig, sich wenigstens einen Ernährer zu angeln, der sie angemessen versorgt. Gerade euch Frauen fällt es doch geradezu im wahrsten Sinne des Wortes in den Schoß, angenehm durch das Leben zu gleiten. Und altbacken stimmen diese Weiber ihr Klagelied an, die Gesellschaft müsste für ihre Versäumnisse einstehen. Schwesterlein! Bei ihrer Attraktivität und jugendlichen Frische öffnen sich für sie alle Türen meilenweit. Und da schlagen sie sich mit den Sorgen dieser plissierten Matronen und senilen Tattergreisen herum? Genießen sie ihr Leben, amüsieren sie sich, solange ihnen dazu die Zeit bleibt. Ich könnte ihnen die Augen öffnen.
Heidrun: Sind sie schon mal auf den Gedanken gekommen, dass sie selber nichts vor dem eigenen Alter schützt?
Herr Schulz: Nein! Ganz gewiss nicht. Bevor ich vor einer Mahlzeit mit dem Krückstock das Glas über den Tisch ziehe, dort zittrig nach den AOK-Beißern fische und am Tischtuch die vorhergegangene Speisekarte von ihnen abwische, um sie mir dann in den Mund zu stopfen, nehme ich mir lieber einen Strick.
Um Gottes Willen! Auf der Parkbank die morschen Knochen ausruhen, dazu genötigt, weil das Gewicht der nach fünf Minuten Spaziergang aussackenden Krampfadern die Füße förmlich am Boden festklebt. Sabbernd und klappernd darüber nachdenken, was es früher außer fressen und saufen sonst noch gab, während der schlaffe Sack um die Kniee schwabbelt? Nein Danke! Das Leben lohnt sich doch nur, solange man noch strotzt vor Manneskraft, um solche kleinen niedlichen Käfer wie sie vernaschen, beglücken zu können.
Darin besteht der Sinn des Lebens, Schwesterchen! Du vergeudest deine schönsten Jahre. Indem du irgendwelche runzligen Elefantenärsche abputzt, schwuppdiwupp, hast du es nicht gesehen. kriegst du die ersten Falten und schleichst bald selbst als vertrocknete Schrippe durch die Lande. Besinne dich lieber auf deine wirklichen Aufgaben, auf deine wahre Berufung als Frau. Wie wäre es, wenn wir beiden Hübschen heute abend in einem lauschigem Lokal unser munteres Pläuschchen fortführen und dabei ins pralle Leben eintauchen?
Selbstgefällig lehnt sich Schulz nach hinten in seinen Schreibtischstuhl und grinst breit die Pflegekraft an. Unverhohlen mustert er ihre Figur und beschreibt mit beiden Händen eine Bewegung, als würde er ihren Busen abtatschen.
Heidrun: Daran zweifel ich nicht, dass sie irgendwelche einschlägigen Lokale kennen. Sie heißen Schulz?
Herr Schulz: Ja, meine Süße.
Heidrun: Und vor fünf Jahren arbeiteten sie auch schon hier?
Herr Schulz: Na klar! Was willst du noch wissen? Meine Konfektionsgröße? Bauchumfang? Oder gleich das Wesentliche? Um zwölf tönt der Gong zum Feierabend. Da leihe ich dir ein Metermaß zum nachmessen.
Heidrun: Nicht nötig. Ich bekam bereits über sie im Vorfeld eine sehr genaue und passende Beschreibung: schwammig, schmierig, feist. Nicht zu vergessen: ungehobelt und niveaulos.
Der Gesichtsausdruck von Schulz gleitet vom Grinsen ins Ärgerliche. Er setzt sich gerade an den Tisch.
Herr Schulz: Sieh dich vor, Mädelchen.
Heidrun: Ich bin nicht ihr Mädelchen. Für sie heiße ich Frau Dreyer. Und ich fuhr bestimmt nicht her, um mich anbaggern zu lassen oder nach Feierabend ihre kümmerlichen zwei Millimeter zu suchen und zu vermessen. Ich vertrete hier die Interessen meiner Patientin, die sie, Herr Schulz, in einer extremen Notlage sträflichst abwiesen. Zu ihrer Verdeutlichung: Ihr Verhalten der Hilfesuchenden gegenüber erfüllte den Tatbestand besonders grober unterlassener Hilfeleistung. Würden sie bitte zumindest heute die Güte haben, ihr damaliges Fehlverhalten schleunigst zu revidieren und sich mit den Unterlagen dieser Frau beschäftigen?
Herr Schulz: Schon wieder so eine frustrierte Emanze. Die Alte soll gefälligst selber anrücken, wenn sie was will. Es warten noch genug Andere auf dem Flur. Schicken sie mir den Nächsten rein.
Heidrun: Nein Freundchen, so klappt das nicht. Sie setzen sich ersteinmal mit den Unterlagen auseinander und tun, wofür man sie hier anstellte und bezahlt.
Sie legt bestimmt den Aktenordner auf den Schreibtisch und wird laut.
Zu ihrem Aufgabengebiet gehört es, Bürger aufzuklären, zu beraten, zu informieren und nicht, sämtliche Sozialhilfeempfäger pauschal zu beleidigen, vor ratsuchenden Bürgerinnen mit ihrem vulgär-sexistisch-hirnlos-perversem Machogehabe zu imponieren oder alte notleidende Menschen wie Schmeißfliegen wegzuscheuchen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wo wirklich der Assi sitzt?
Schulz nun wütend, stützt sich auf seinem Schreibtisch auf.
Herr Schulz: Was erlauben sie sich, in meinem Büro derart herumzuschreien. Sie tollwütige Suffragette! Sie hysterische Kuh! Augenblicklich verlassen sie mein Büro.
Nachdem Schulz schreit, wird Heidrun wieder betont ruhig.
Heidrun: Dieses Zimmer ist nicht ihr Büro. Sie haben diese Räumlichkeit weder gekauft, noch gemietet oder gepachtet. Es ist auch nicht ihr Sozialamt. Und das Rathaus gehört ihnen ebenfalls nicht. Ferner entspringen die Finanzen, die sie verwalten, nicht ihrer ureigenen Geldbörse. Nein, nein! Dafür, dass sie sich in diesem Raum gegen Besoldung aufhalten dürfen, ganz genau dafür zahle ich Monat für Monat, wie Tausende anderer ehrlicher Menschen auch, Steuern. Und von daher wäre es ungemein rührend, falls sie sich endlich dazu bequemen könnten, dem Engagement der Steuerzahler soviel Achtung entgegenzubringen, rückhaltlos ihre Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen. Kurzum: erledigen sie ihre Arbeit.
Der Sachbearbeiter springt auf.
Herr Schulz: Du dämliche Göre! Vielleicht lasse ich mir von so einem hergelaufenen Flittchen vorschreiben, was ich zu tun habe. Raus!
Heidrun: Großzügigerweise überhöre ich das Flittchen. Ansonsten bitte Sie Göre, mein Herr. Wenn schon, dann Sie. Denn ich erinnere mich nicht, dass wir bereits zusammen Schweine hüteten.
Klappt den Aktenordner von Frau Kowalski auf und weist auf den Inhalt.
Bitte! Hier ist der Rentenbescheid, Mietquittung...
Herr Schulz: Sie sollen verschwinden.
Heidrun: Eben das mache ich nicht. Die alte Dame besitzt nicht einmal das Lebensnotwendige. In der Wohnung herrscht klirrende Kälte. Ich kenne meine Pflichten als Staatsbürger. Der Fall ist zweifelsfrei nachvollziehbar und überprüfbar. Ich setze keinen Fuß vor das Gebäude, ehe ich ein ausreichendes Überbrückungsgeld für sie in Händen halte.
Herr Schulz: Was stellen sie sich denn vor? Dass sie ein paar Minuten vor zwölf hereinschneien und ich sofort Bargeld aushändige? Bei ihnen piept es wohl.
Heidrun: Die Frau befindet sich in einer akuten Notlage. Auf so eine Situation muss ganz einfach eine Sozialbehörde in der Lage sein, adäquat und unmittelbar zu reagieren.
Herr Schulz: Sie spinnen ja. So schnell funktioniert ein Vorgang eh nicht. Bei gebotener Eile müssen die Verwaltungswege trotzdem eingehalten werden. Kommen sie nach den Feiertagen wieder.
Heidrun: Äh – ich bin zwar manchmal begriffsstutzig, aber nicht blödsinnig. Und ich gehöre auch nicht zu den Analphabeten. Was las ich auf dem Anschlag im Flur? Heute, Freitag, der einundzwanzige Dezember, Publikumsverkehr bis zwölf Uhr. Montag, Heiligabend, bleibt das gesamte Rathaus geschlossen. Donnerstag und Freitag, den sieben- und achtundzwanzigsten Dezember, hindern betriebsinterne Gründe sie an der Arbeit. Sylvester wird gehandhabt wie Heiligabend. Mittwoch bis Freitag, den zweiten bis vierten Januar, veranstalten sie eine Inventur, was meinen Spatzenverstand völlig überfordert.
Herr Schulz: Auch Behörden überprüfen ihre Bestände.
Heidrun: Und lagern derartige Massen, dass man ganze drei Tage benötigt, um sie zu erfassen? Das KaDeWe erledigt seine Inventur an einem einzigen Tag. Auf dem Aushang wirkten die paar Tage ganz harmlos, an denen in dem Laden hier nichts stattfindet. Die Wochenenden und Feiertage dazwischen erwähnte man ja wohlweislich auch nicht.
Herr Schulz: Die dürften bekannt sein.
Heidrun: Aber nicht jeder rechnet nach und stellt fest, dass das Sozialamt sich einen sechzehntägigen Sonderurlaub gestattet und erst wieder am 7. Januar öffnet. Ihnen mag es gelingen, eine hilflose, eingeschüchterte Rentnerin wegzuschicken, aber nicht mich. Im Übrigen genügen wohl fünf Jahre, die nötigen Schritte zu veranlassen und die von ihnen so geschätzten Verwaltungswege einzuhalten. Bevor sie ihre Beine gemütlich vor dem Weihnachtsbaum ausstrecken und sich vergnügt im Sessel räkeln, tragen sie erst dafür Sorge, dass dieses Weihnachten nicht das letzte Weihnachtsfest für meine Patientin ist. Das garantiere ich ihnen. Denn in vierzehn Tagen kann sie bereits erfroren oder verhungert sein. Zu ihrer Information: die Frau brach im Sommer auf der Straße vor Erschöpfung zusammen, Folge der krassen Unterernährung, Herr Schulz. Im Krankenhaus päppelte man sie über Monate auf. Ihr Organismus gewöhnte sich in letzter Zeit an eine regelmäßige ausreichende Ernährung. Was meinen sie wohl, was passiert bei einer erneuten Hungerperiode? Herr Schulz! Schlimmstenfalls besteht für sie Lebensgefahr.
Herr Schulz: Ach Quatsch! Was die Alte in fünf Jahren nicht schaffte, wird sie nun in zwei Wochen auch nicht vollbringen. Unkraut vergeht nicht. Zu zäh! Und wenn schon! Zehnmal ziepen sie es aus und zehnmal wächst es nach. Außerdem tun sie doch so besorgt um ihre Patientin, setzen sich mit aller Macht für sie ein. Dann werden sie sie auch nicht darben lassen.
Heidrun: Ha, das könnte ihnen so passen. Wissen sie, für mein Gehalt schufte ich verdammt hart. Logisch! Das können sie nicht nachvollziehen angesichts der unglaublichen Tatsache, dass sie Anträge von vornherein aus Bequemlichkeit, Ignoranz und Selbstgefälligkeit abschmettern. Ausgerechnet ich löhne dann freiwillig für ihre Schlampigkeit? Noch bin ich zu retten, aber sie konsultieren besser einen Psychiater.
Herr Schulz: Aufwiedersehen! Beziehungsweise besser auf Nimmerwiedersehen! Feierabend! Das Rathaus schließt für den öffentlichen Publikumsverkehr.
Heidrun: Aber nicht für mich. Mir fehlt immer noch das Überbrückungsgeld. Ich pflege meine Versprechungen zu halten: ohne Moos laufe ich nicht los.
Herr Schulz: Ich gehe!
Heidrun: Bitte! Es läßt sich wohl nicht verhindern. Aber ich bleibe.
Herr Schulz: Nein. Sie räumen jetzt ganz fix dieses Zimmer.
Drohend baut sich Schulz vor der sitzenden Pflegerin auf.
Heidrun: Beileibe nicht!
Herr Schulz: Dann schmeiße ich sie raus.
Heidrun: Unterlassene Hilfeleistung, Beleidigung, Bedrohung und nun auch noch Körperverletzung? Ich überlege gerade, ob ich meine Rechtschutzversicherungsprämie zahlte? Ach ja – für diese füllte ich eine Einzugsermächtigung aus. Damit ich die fristgerechte Überweisung nicht verschussel. Von daher müßte alles in Ordnung sein. Wenn sie vor Gericht genauso auftreten wie hier, gibt das aber eine unterhaltsame Verhandlung. Na – man gönnt sich ja sonst nichts.
Herr Schulz: Sie dämliches Luder! Was sie hier treiben ist Hausfriedensbruch. Ich fordere sie zum letzten Male auf, hinauszugehen und zwar mit Tempo!
Heidrun: Mit dem Hausfriedensbruch kann ich leben. Und für diese letzte Aufforderung bin ich ihnen sehr dankbar. Dann brauche ich nicht unentwegt wiederholen, dass ich mich nur mit Geld von dieser gastlichen Stätte entferne. Langsam komme ich mir wie eine zerkratzte Schellackplatte vor, die unentwegt dasselbe plärrt, weil die Grammophonnadel ständig in die gleiche Rille zurückrutscht.
Herr Schulz: Verduften sie!
Heidrun: Schade! Und ich dachte schon, sie stehen zu ihrem Wort.
Herr Schulz: Mit ihnen werde ich fertig. Da bin ich schon mit ganz anderen fertig geworden. Ich habe gelernt, wie man mit euch Pennern umspringt. Da gibt es noch schärfere Mittel.
Heidrun: Kontrollieren sie mal bei Gelegenheit Ihren Blutdruck. Mit dem stimmt was nicht. Vielleicht sehen wir uns dann wieder, weil ihnen der Arzt Hauskrankenpflege verordnet. Für diesen Fall geben sie mir rechtzeitig Bescheid, damit ich sie in meiner Tour noch einplanen kann.
Herr Schulz: Was genug ist, ist genug.
Wütend stürmt Herr Schulz aus dem Büro und schmeißt mit aller Gewalt die Tür zu.
Heidrun: Stimmt, Herr Schulz! Was rennt der denn jetzt raus, wo wir endlich mal einer Meinung sind?
Heidrun sieht sich im Büro um. Die Tür öffnet sich wieder und Herr Schulz betritt mit einem weiteren Mann, im gleichen Stil wie dieser gekleidet, den Raum.
Herr Schulz: Bitte, Herr Amtsleiter! Da sitzt dieses Subjekt, was sich beharrlich weigert, das Amtsgebäude zu verlassen.
Heidrun: Guten Tag, Herr...?
Der Sozialamtsleiter tritt zu Heidruns Stuhl.
Herr Meyer: Meyer! Also nun werden wir hübsch vernünftig und gehen einfach. Sonntag feiern wir den vierten Advent, Montag Heiligabend, da verderben wir uns doch nicht die schöne Festtagslaune. Angesichts Weihnachten, dem Fest der Liebe, zeigen wir uns nicht als Unmenschen und vergessen mal diesen heutigen Zwischenfall. Na also! Kommen sie!
Beim letzten Satz legt er seine Hand auf ihre Schulter und schiebt Heidrun etwas nach vorne, die der Hand jedoch ausweicht.
Heidrun: Rühren sie mich bitte nicht an. Aber fein, Herr Amtsleiter Meyer, dass sie Vernunft vorschlagen. Dann kann ich ihnen ja gleich mein Problem erörtern.
Herr Meyer: Gute Frau – doch heute nicht mehr. Wissen sie, wie spät wir es haben? Ich bin mit meiner Frau zu Weihnachtseinkäufen verabredet.
Heidrun: Genau um Weihnachtseinkäufe dreht es sich, Herr Meyer. Sehen sie, ich möchte für meine Patientin einkaufen, damit sie am Weihnachtsfest nicht hungert. Sie hat nämlich weder zu essen noch Bares.
Herr Meyer: Das erzählen sie mir alles nach dem Fest, meine Liebe. Da nehme ich mich persönlich ihrer Sache an.
Heidrun: Am siebenten Januar? Bis dahin erledigt sich die Sache von alleine. Die Frau braucht heute Nahrung und nicht erst zu Pflaumenpfingsten.
Herr Meyer: Ich hielt sie wirklich für einsichtiger. Offensichtlich wünschen sie es, dass man ihnen nachhaltiger beibringt, die gängigen Regeln anzuerkennen. Hiermit fordere ich sie letztmalig auf, die Amtsstube zu verlassen.
Heidrun: Ich leiste ihrer freundlichen Bitte unverzüglich Folge, Herr Meyer, wenn sie mir vorher für meine Patientin einen Vorschuß zum Lebensunterhalt gewähren.
Herr Meyer: Sagen sie mal. Sie begreifen wohl nicht den Ernst ihrer Lage. Das kann für sie ein juristisches Nachspiel haben.
Heidrun: Mit Sicherheit! Denn ich wurde mit der Betreuung der alten Dame beauftragt. Und erfriert sie oder stirbt an den Folgen ihrer Unterernährung, stellt mir der Staatsanwalt ganz gewiss einige reichlich unangenehme Fragen.
Herr Meyer: Also Schulze, die tickt ja nicht sauber. Verständigen sie die Polizei. Im Grunde genommen müsste die Landesnervenklinik so ein irrsinniges Weib abholen. Sie haben mich verstanden, ja? Wir lassen sie von der Polizei räumen.
Heidrun: Ich bin ja nicht taub. Die Telefonkosten könnten sie sich allerdings sparen, wenn sie mir endlich den Antrag meiner Patientin bearbeiten.
Herr Meyer: Sie verweigern also weiterhin, meiner Forderung nachzukommen?
Heidrun: Ja! Ich kehre nicht zu der alten Dame mit leeren Händen zurück.
Herr Meyer: Schulze, ruf an! Führen sie das Telefonat von meinem Apparat. Wer weiß, wie die sonst noch ausrastet.
Herr Schulz: Sehr wohl, Herr Meyer!
Die beiden Männer verlassen den Raum und werfen wiederum lautstark die Tür zu. Die Pflegerin bleibt sitzend am Schreibtisch zurück.
Heidrun: Pah! Kein Wunder, dass bei denen die Inventur so lange dauert, wenn sie ständig derart die Türen schmeißen. Vermutlich bersten ihre Keller vor Kleinholz. Und der arme Herr Schulz und der arme Herr Meyer hocken drei Tage im Keller und sammeln und addieren, wieviele Splitter, wieviele Späne bilden eine Tür und wieviele Türen ergibt das im Gesamten. Und ich Niederträchtige unterstelle ihnen auch noch, dass die Inventur vorgeschoben sei. Tzz! Tzz! Tzz! Tzz! Arme Beamte! Böse Bürger! Ein Holzspan für Schulz, ein Spänlein für Meyer, ein Splitter für Schulz und ein Brettchen für Meyer, Ein Riesenbrett für Schulz und eine Zarge für Meyer.
Die Tür wird wieder geöffnet. Schulz, Meyer und zwei auffallend junge Polizeibeamte in Uniform betreten das Büro.
Heidrun: Donnerwetter. Das ging aber schnell. Mensch Herr Schulz, von denen können sie ja richtig was lernen.
1. Polizeibeamter: Maul halten!
Heidrun: Angenehm! Und ich heiße Heidrun Dreyer!
1. Polizeibeamter: Papiere!
Heidrun ergreift Kowalskis Aktenordner und zeigt auf dessen Inhalt.
Heidrun: Da hätte ich den Rentenbescheid der alten Dame, die hungernd und frierend zu Hause sitzt, die Mietquittungen, den.....
2. Polizeibeamter: Lassen sie die Faxen! Ihren Personalausweis!
Heidrun: Ach so! Bitteschön! Zieht Dienstausweis und Personalausweis aus der Tasche. Hier ist mein Dienstausweis und der Personalausweis.
1. Polizeibeamter: Sie folgen uns.
Heidrun: Nein! Ich bleibe solange hier, bis ich für meine.....
Blitzschnell ergreift der Polizist ihren Arm und verdreht ihn. Der Aktenordner von Frau Kowalski fällt zu Boden, den der zweite Polizist aufhebt und mitnimmt. Der erste Polizeibeamte geht voran, den Griff an Heidruns Arm nicht lockernd, sodass sie gezwungenermaßen gebeugt vor ihm herlaufen muss. Auf diese Art bugsiert er sie aus dem Zimmer unter dem triumphierenden Gegrinse von Herrn Schulz und Herrn Meyer.
Heidrun: Aua! Sie tun mir weh! Lassen sie das!
- Vorhang! -

3. Bild
Alte Bekannte
Nach dem Öffnen des Vorhanges sieht man wieder das Büro des Sozialamtes. Herr Schulz steht vor seinem Schreibtisch mit einer Aktentasche in der Hand und packt verschiedene Sachen in diese und räumt offensichtlich den Schreibtisch auf. Die Tür öffnet sich und die Pflegerin erscheint.
Heidrun: Kuckuck, Herr Schulz, da bin ich wieder. Also manchmal ähnel ich doch wirklich so einem zerstreuten Professor. Vergaß ich doch eben glatt das Geld der alten Dame. Wo liegt es denn?
Völlig entgeistert starrt Herr Schulz die Pflegerin an, um dann loszuschreien und aus dem Zimmer zu laufen, wieder einmal die Tür zuwerfend.
Herr Schulz: Nein! Nein! Diese Teufelsbrut! Diese Teufelsbrut! Herr Meyer! Herr Meyer! Kommen Sie schnell! Die Irre ist schon wieder da.
Heidrun Dreyer setzt sich an den Schreibtisch.
Heidrun: Du musst das Durchstehen. Irgendwie musst du es durchstehen. Was sollen die klappernden Nerven? Konzentriere dich auf anderes, denk an etwas Schönes. Die Welt besteht schließlich nicht nur aus Amtsstuben. Dein letzter Urlaub! Sonne! Abends am Strand mit Freunden eine Flasche Rotwein trinken, über uns die Sterne, klar und in naher Weite, majestätisch stumm die Erkenntnis bergend, wie klein, wie unwichtig, wie nichtig du in diesem Universum bist. Die Höhlen im Berg, die du per Zufall entdecktest, weil man sie nur unter Wasser erreicht. Unheimlich war es schon, Meter um Meter durch absolute Finsternis zu gleiten und zu wissen, dass ein Auftauchen nicht möglich ist, weil Felsen das Wasser begrenzen und keine Sonne über der Wasseroberfläche strahlt. Der Anflug von Panik, was, wenn plötzlich der Sauerstoff versagt? Keine Chance, keine Rettung! Ruhig bleiben und weitertauchen.
Angst tötet. Zugegeben, eine leichtsinnige, nicht ganz ungefährliche Aktion. Aber in den Höhlen die Spuren längst vergangener Generationen, als man sie vermutlich noch über den Landweg erreichte, dieses Gefühl, Mutter Erde ein Geheimnis zu entreißen, als einer der wenig Auserwählten in der Vergangenheit herumzustöbern, ungestraft ein verbotenes Buch der Geschichte aufzuschlagen – das lohnte die Momente der Furcht.
Du beneidest die Fischer, die täglich jahrein, jahraus am und auf dem Meer leben dürfen. Aber ehrlich, ist es das, was du erträumst? Selten ein Auge für die Schönheit der großen See, im Existenzkampf denen nachstellen, die dich so faszinierten? Die Fische, die staunten, was für ein ungeschicktes, linkisches Wesen sich zu ihnen in die Tiefe wagte. Da bildete ich mir immer etwas auf meinen gewandten Schwimmstil ein. Frech und neugierig begutachteten sie genau mich unförmiges Dingsda. Schwammen direkt zum Greifen nahe um meinen Kopf und Flossen herum, als wüssten sie nicht, welche mörderische Gefahr für sie vom Menschen ausgeht. Der mit engmaschigen Netzen ihnen feige nach dem Leben trachtet. Der eiskalt die Harpune auf sie richtet, auf sie, die elegant zum Tölpel heranschwimmen, um ihm das Lied von der Freiheit, vom Frieden, von der Unbekümmertheit zu singen.
Mein Aquarium daheim wandelte sich plötzlich in einen gläsernen Käfig. Ein beengtes künstlich geschaffenes Miniuniversum, nichts gemein mit der Unendlichkeit des Meeres, wo jeden Tag ein Gott, sich seiner allgegenwärtigen Macht und Stärke bewusst, Futterflocken hineinwirft. Dieser Raum hier gleicht auch einem Aquarium mit einem Schulze und Meyer als selbernannten Göttern, die den armseligen, gefangenen Geschöpfen vorschreiben, wieviel Liter Atmoshäre ihnen zusteht und zynisch lächelnd gnädig einige Krümel Trockenfutter hinstreuen.
Wie ich diese Gestalten mit ihrer grandiosen Selbstüberschätzung verachte. Nein Heidrun, Lug und Trug, das Dasein der Fischer romantisch zu verklären, deren Leben mindestens genausoviel Schattenseiten zeigt wie deins. Es gilt, auf seinem Platz gerade zu stehen und zu leisten, was man vermag. Frau Kowalski, sie kriegen ihr Geld. Heute! Keinen Betteltaler! Das, was ihnen rechtlich zusteht. Ich gebe nicht klein bei. Und wenn ich mir vor Angst in die Hosen scheiße – kneifen gilt nicht.
Leise singt Heidrun vor sich her.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,
sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen,
es bleibet dabei: die Gedanken sind frei.
Ich denke, was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still und wie es sich schicket
Ja Pustekuchen! Dieses alte Widerstandslied empfiehlt als Kampfmittel die innere Emigration? Da überlieferte aber irgendjemand gewaltigen Mist. Und heute fällt mir erst auf, welchen Unfug ich da lernte.
doch mmh mmh in der Still......
doch mmh mmh in der Still......
Niemals. niemals gehört da rein und nicht alles.
doch niemals in der Still und wie es sich schicket
Na logisch! Jetzt stimmt die Aussage.
Ich denke, was ich will und was mich beglücket,
doch niemals in der Still und wie es sich schicket
Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren,
es bleibet dabei: die Gedanken sind frei.
Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker;
das alles sind rein vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei.
Das Zimmer betreten Schulz, der eilfertig und fast unterwürfig die Tür öffnet, Meyer und zwei Polizeibeamte, diesmal sind es aber ältere Polizisten wie eben. Der eine Polizist erkennt beim Betreten sofort die Frau, stutzt und beginnt breit zu grinsen.
3. Polizeibeamter: Ah – sie einer an! Das Karbolmäuschen der roten Hilfe! Was verschlägt dich denn hierher?
Heidrun: Meine gewerkschaftlich zugesicherte Pause!
3. Polizeibeamter: Gibt es hier eine Demo? Vielleicht entging uns etwas?
Herr Meyer: Ach, die kennen sie. Dachte ich mir gleich, dass die schon aktenkundig ist. Eine Kommunistenbraut also, ein Chaotenweib.
Herr Schulz: Solche roten Flintenweiber sollte man gleich nach drüben abschieben, diese bolschewistischen Huren.
3. Polizeibeamter: Na, na, meine Herren. Ihre Äußerungen reichen hinlänglich für eine Anzeige wegen Beleidigung. Ich darf doch sehr bitten.
4. Polizeibeamter: Rote Hilfe?
3. Polizeibeamter: Ja, das sind die Sanitäter, die die Demonstranten mit sich führen.
Heidrun: Darf ich das erklären? Man behauptet, dass wir eine Demokratie besäßen. Zu einer Demokratie gehören aber auch freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht. Wenn allerdings ihre aufgeheizten Kollegen offensiv mit Knüppeln und Wasserwerfern diese demokratischen Grundrechte bekämpfen und sich sofort sämtliche georderten Krankenwagen feige hinter die Polizeiketten zurückziehen, traut sich irgendwann niemand mehr, seine elementaren Rechte der Demokratie......
Herr Meyer: Ruhe! Schluss! Muss ich mir hier diese Rote-Socken-Agitation weiter gefallen lassen? Schmeißen sie diese Missgeburt endlich heraus.
3. Polizeibeamter: Ich sagte ihnen bereits, sie sollen diese Verunglimpfungen unterlassen.
4. Polizeibeamter: Außerdem, was haben sie gegen Demokratie? Ich müsste mich sehr irren, wenn wir nicht dem gleichen Arbeitgeber unterstehen.
Wieder zum anderen Polizisten gewandt.
Und diese Sanis der roten Hilfe mischen dann also reichlich mit, wenn es Randale gibt?
3. Polizeibeamter: Habe ich noch nicht erlebt. Die verhalten sich auf Demos stets betont neutral.
Heidrun: Teilweise schätzen auch die Rinderherden ungemein unsere Dienste, nicht wahr, Herr Oberhauptwachtmeister. Was macht das Knie?
3. Polizeibeamter: Oh, danke der Nachfrage! Alles gut abgeheilt!
4. Polizeibeamter: Was hat sie denn mit deinem Knie zu schaffen?
3. Polizeibeamter: Bei einer Demo verarztete sie mich, als ich mir das Knie übel aufschlug.
Heidrun:
zum 4. Polizeibeamter
Aber wie das passierte, das war die Schau. Springt hinten auf das Trittbrett der Wanne und will einsteigen.....
3. Polizeibeamter: Karbolmäuschen, das reicht!
Heidrun: Schreit eine vorbeikommende Tunte: absitzen, ihr kleinen grünen Strichjungs des Berliner Senates. Alles gröhlt..........
3. Polizeibeamter: Du spielst gerade mit deiner Rente, Mädchen.
Heidrun: Und ihr werter Kollege hört nur absitzen, reagiert natürlich gut gedrillt augenblicklich und will beim einsteigen unvermittelt wieder aussteigen. Wanne fährt los, er zappelt in der Luft wie ein Karpfen im Netz, bis ihm dann doch die Schwerkraft die Richtung weist. Mann, ist der auf das Maul gefallen.
3. Polizeibeamter: Ja, ja, ja!
Heidrun: Urkomisch sah es aus. Wie ein Charlie-Chaplin-Slapstick! Hätte das ein Kamerateam gedreht, wäre er heute ein Filmstar. Da blieb noch nicht einmal bei den Bullen vor Lachen ein Auge trocken.
3. Polizeibeamter: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen.
Heidrun: So entstehen die Verletztenzahlen für die Polizeistatistik. Aber immerhin brachte es etwas Gutes. Unter dem Gelächter endeten schließlich schlagartig die beidseitigen Aggressionen und somit die Bambule. Sie Armer blieben an dem Tag der letzte Kandidat für meine Sanitasche. Angesichts dessen, was hätte geschehen können bei weiterer Eskalation, war das aufgerissene Knie ein für sie zwar unangenehmes und zweifelsfrei schmerzhaftes, aber eingrenzbares Opfer und es wohl wert.
Herr Schulz: Lassen sie sich etwa bieten, dass der rote Mistkäfer sie verspottet?
3. Polizeibeamter: Langsam überstrapazieren sie meine Geduld. Zum wiederholten Male höre ich von ihnen über diese Frau geringschätzige und verleumderische Bemerkungen. Sie fordern förmlich, dass ich mich als Zeuge zur Verfügung stelle, aber bestimmt nicht ihnen.
Heidrun: Ach lassen sie mal, Schupolein. Mit dem Vokabular dieser Herren bin ich bereits bestens vertraut. Die Bezeichnung Mistkäfer ist noch das harmloseste, was man mir hier bot. Außerdem gehören zu diesen sehr nützlichen Tieren meines Wissens nach auch der Skarabäus, ein ausgesprochen schönes Lebewesen und vielen Menschen heilig. Da nehme ich diese Bemerkung fast als Kompliment auf.
Herr Schulz: Ich erstatte Anzeige.
4. Polizeibeamter: Warum? Weil sie ihre Beleidigungen ignoriert?
Herr Meyer: Ähh! Als Amtsleiter genieße ich das Hausrecht und ich stelle Anzeige wegen Hausfriedensbruch.
4. Polizeibeamter: Da müssen sie sich schon auf das Revier bemühen.
Herr Meyer: Ihr Kollege droht mir mit einem Verfahren wegen Beleidigung und meine Anzeige nehmen sie nicht auf?
4. Polizeibeamter: So ist es!
Herr Meyer: Ich fordere sie auf, ihre Arbeit vorschriftsmäßig im Interesse unbescholtener Bürger auszuüben.
4. Polizeibeamter: Möchten sie mich über meine Dienstvorschriften belehren?
Heidrun: Hört! Hört! Genau darum bat ich diese Herren die ganze Zeit.
Herr Schulz: Sie baten um gar nichts. Sie hielten hier eine Demonstration, ein unerlaubtes Sit-In ab und hinderten uns an der Arbeit, wenn sie überhaupt wissen, was Arbeit ist.
Heidrun: Ich weiß sehr gut, was Arbeit ist, keine Sorge. Mein Arbeitstag beginnt, wenn sie noch gemütlich an der Matratze lauschen und endet, wenn sie bereits wieder das Gleiche tun. Und ich hielt sie auch nicht von ihrer Tätigkeit ab. Im Gegenteil! Ich versuchte, sie an diese zu erinnern, als sie gedachten, vorzeitig ins Wochenende zu starten.
Herr Schulz: Ich teilte ihnen bereits mit, dass sie nicht kurz vor zwölf in meinem Büro eindringen und von mir erwarten können, dass ich augenblicklich nach ihrer Pfeife tanze.
Heidrun: Ach nein! Um mir den Hof zu machen und um mich herumzuschwänzeln, dafür reichte dicke die Zeit. Aber um ein fünfjähriges Versäumnis zu berichtigen, dafür war es zu spät?
Herr Schulz: Ich um sie herumschwänzeln? Ich bitte sie? Im Traum fiele es mir nicht ein, auf so eine wie sie ein Auge zu werfen.
4. Polizeibeamter: Das verstehe ich nun aber gar nicht. Ich finde die junge Frau sehr apart.
Heidrun: Aber im Gegensatz zu Herrn Schulz äußern sie es nicht auf ausgesprochen vulgäre Art und Weise.
4. Polizeibeamter: Bei Belästigungen im Dienst rate ich ihnen dringend zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde.
Heidrun: Na großartig! Und die lege ich einem Herrn Meyer vor, der sie prompt in den Papierkorb schmeißt.
Herr Meyer: Ich überprüfe jede Dienstaufsichtsbeschwerde.
Heidrun: Fein! Dann frage ich mich nur, warum sie nicht genauso die Akte meiner Patientin überprüften und den dargelegten Sachverhalt über die Notlage dieser Frau, die Herr Schulz vor fünf Jahren vorsätzlich verkehrt informierte und deren Hilfeersuchen er einfach abwies.
Herr Meyer: Ich kenne sämtliche Vorgänge in meinem Amt und bin stets ausgezeichnet über die Vorgehensweisen meiner Mitarbeiter orientiert.
Heidrun: So? Dann werden sie mir gewiss den Namen der alten Dame nennen können?
Herr Meyer: Das tut doch jetzt hier nicht zur Sache.
Heidrun: Doch das tut es. Schließlich stellten sie soeben die Behauptung auf, dass sie sich mit der Angelegenheit beschäftigten.
Herr Meyer: Mir ist gerade der Name der Person entfallen. Wie hieß sie noch, Schulz?
Herr Schulz: Äh! Wir unterliegen dem Datenschutz. Wir können nicht einfach die Personalien unserer Klienten preisgeben.
3. Polizeibeamter: Dürfen sie, dürfen sie. Wir als Polizeibeamte wahren vertrauliche Informationen und leiten sie mit Sicherheit nicht an unbefugte Dritte weiter. Wie heißt denn nun die Frau, die offensichtlich in größeren Schwierigkeiten steckt?
Herr Schulz: In der ganzen Aufregung und bei dem Theater mit dieser.....
4. Polizeibeamter: Vorsicht!
Herr Schulz: Pflegerin vergaß ich den Namen.
Heidrun: Es handelt sich um Frau Kowalski! So genau verfolgen sie also den Hinweis, dass eine Mitbürgerin ohne Soforthilfe sich in akuter Lebensgefahr befindet.
3. Polizeibeamter: Jetzt trägst du aber ein bißchen dick auf, Karbolmäuschen.
Heidrun: Ich übertreibe kein bisschen. Die alte Dame hungert, friert und fristet unter menschenunwürdigsten Verhältnissen ihr Dasein.
3. Polizeibeamter: Hungern, frieren – aber nicht in unserem reichen Deutschland.
Heidrun: Auch in unserem reichen Deutschland geschieht es, wenn man auf völlig unfähige Beamte stößt.
Herr Meyer: Diese Frau leidet unter Hirngespinsten, Wahnvorstellungen. Ihre Vowürfe sind aus der Luft gegriffen und völlig haltlos. Ich lasse mich auch nicht weiter hinhalten. Wir baten sie um Amtshilfe, um diese Person, die sich unerlaubt im Gebäude herumtreibt, zu entfernen.
4. Polizeibeamter: Das Rathaus ist doch ein öffentliches Gebäude.
Herr Schulz: Sie bekam bereits Hausverbot erteilt.
Herr Meyer: Ihre Kollegen, die sie nicht einmal vor einer halben Stunde, einer knappen halben Stunde, herausschmissen, sagten uns fest zu, dass wir vor weiteren Belästigungen verschont bleiben. Wir dachten, die sperren sie ein. Stattdessen läßt man sie laufen, damit sie weiter Unruhe stiftet.
4. Polizeibeamter: Falls sie annahmen, dass ein Bürger wegen einer derartigen Lapalie in den Knast einfährt, muss ich sie enttäuschen. Gehen sie doch rüber in den Osten, da genügt schon ein einziges verkehrtes Wort für Bautzen.
Heidrun: In den dortigen Amtsstuben treffen sie auch viele Gleichgesinnte. Nur gibt es in einem Arbeiter- und Bauernstaat keine Beamte. Eine hervorragende Sache: falls sie einen Antrag nicht bearbeiten wollen, dann bebauern sie eben gerade.
3. Polizeibeamter: Nein, ist das schön blöd. Ich stelle mir gerade vor, wie die Herren mit ihren Traktoren durch das Amt tuckern und die Akten unterpflügen. Trotzdem müssen wir dich zu meinem Bedauern an die frische Luft befördern, Karbolmäuschen, hilft alles nichts.
Heidrun: Mir tut es erst recht leid, Jungs. Ich hoffe auf euer Verständnis, dass ich nicht freiwillig euch zuliebe aus diesem Hause weiche. Und prompt klären sich wieder die Linien.
3. Polizeibeamter: Ach Prinzesschen. Es gibt immer wieder Zeiten, da auch die Feindeslager gezwungenermaßen statt hauen und stechen miteinander kommunizieren und verhandeln müssen. So kurz vor Weihnachten blühen uns ganz andere Einsätze. Familienzwiste, oft genug nicht nur temperamentvoll ausgefochten, sondern mit bemerkenswerter Brutalität geführt. Schnapsleichen über Schnapsleichen, die volluriniert uns auch noch den Einsatzwagen vollkotzen. Lieber schleife ich da im Dienst ein nettes Karbolmäuschen die Treppe runter als einen besoffenen Radikalinski aus der Kneipe, der mir dabei womöglich in seinem Suff versehentlich mit einem Bierhumpen einen zusätzlichen Scheitel zieht. Als zum zweiten Male der Funkspruch zum Einsatz ins Rathaus aufforderte, da riefen sofort vier Funkstreifenbesatzungen Juchhu.
4. Polizeibeamter: Wir Glücklichen schrieen diesmal zuerst und am lautesten und ließen uns den Hauptgewinn nicht wieder vor der Nase wegschnappen.
3. Polizeibeamter: Wegen uns brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Ehre liegt ganz auf unserer Seite.
Der 3 Polizeibeamte tritt auf die Frau zu und umgreift ihre Hüfte, um sie aus dem Stuhl hochzuschieben. Sie zuckt allerdings zusammen und schreit auf.
Heidrun: Aua!
3. Polizeibeamter: Aber Mädchen! Ich habe doch nicht grob zugelangt?
Heidrun: Ihr nicht! ! Aber eure Vorgänger! Die schubsten mich die Rathaustreppe herunter. Die ganze Seite tut mir weh.
3. Polizeibeamter: Invaliden Damen gegenüber mangelt es uns nie an Aufmerksamkeit. Komm Kollege! Wir bilden mit den Händen einen Sitz, da kann sie sich raufsetzen und an unseren Schultern festhalten und ab geht die wilde Luzie.
Zur Pflegerin gewandt:
Genügt es deinem Seelenfrieden, dass du das Rathaus nicht aus eigener Kraft verlassen hast?
Heidrun: Tja – eigentlich eigne ich mich nicht für das Heldentum. Helden neigen häufig zu Fanatismus und Dummheit, unfähig für ein gewisses diplomatisches Geschick und Abwägung berechtigter Interessen und Ziele. Angesichts der Umstände erscheint euer Angebot ratsam und klug durchdacht, besonders vor der Tatsache, dass ich von Natur aus eher ein Hasenfuß bin.
Die Polizisten bilden mit den Händen einen sogenannten Rettungssitz, auf denen sich Heidrun setzt.
3. Polizeibeamter: Hopp, rauf hier!
4. Polizeibeamter: Langsam! Bloß nicht so schnell! Die nächste Spelunke oder Familiendrama lauern schon auf uns.
3. Polizeibeamter: Na, geht es?
Heidrun: Ungemein gemütlich und bequem!
Die drei verlassen während ihres lockeren Gespräches den Raum.
3. Polizeibeamter: Nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Pflichtgemäß müssen wir dich darüber aufklären, dass du hier nicht mehr aufkreuzen darfst. Sozialamt ist jetzt Pfui, Pfui, Pfui für dich.
Heidrun: Und falls ich selber in eine Notlage gerate?
3. Polizeibeamter: Gute Frage?
4. Polizeibeamter: Ja, bei Gefahr im Verzuge?
3. Polizeibeamter: Aeih, du kleines böses Ding. Ich ahne, worauf du hinauswillst.
4. Polizeibeamter: Wer macht denn dann die Drecksarbeit, wenn wir alle Nase lang aufmüpfige Pflegerinnen aus dem Rathaus abholen?
Heidrun: Vielleicht die dienstbeflissenen übereifrigen zackigen Bullen, die sich einbilden, Stiere zu sein und mich beim ersten Male derart unsanft räumten. Offenbar lieben sie preußisch geglättete Scheitel und können nicht genug davon haben.
3. Polizeibeamter: Ach, die stoßen sich auch noch die Hörner ab.
4. Polizeibeamter: Lieber nicht! Dann bekämen wir Konkurrenz.
Nachdem das Gelächter und Gescherze verstummt, kommt wieder Bewegung in Schulze und Meyer, die völlig entgeistert den Davongehenden lauschten.
Herr Meyer: Schulze. Sie gehen hinterher und sorgen sofort dafür, dass der Pförtner die Haupttür abschließt. Sonst zischt die wie ein Bumerang in zehn Minuten wieder rein.
Herr Schulz: Sehr wohl, Herr Meyer!
Schulze verlässt das Büro.
Herr Meyer: Diese Welt ufert mehr und mehr ins Abstruse. Statt ihr die Flausen aus der Birne zu hämmern, schäkern die Polizisten noch mit dem roten Gelumpe. So etwas gab es früher nicht.
Ganz in Gedanken stellt er sich stramm, Hände an der Hosennaht, hin.
Adolf mistete gründlich aus, befreite das Reich von derartigen Untrieben, Provokationen und Polizisten waren noch ganze Kerle und kannten Loyalität. Kommunistische Säue verschwanden in Arbeitslagern und lernten rechtzeitig Zucht und Ordnung anstatt ihre anarchistische Propaganda unbehelligt verbreiten zu dürfen. Nur weil wir den Krieg verloren, drücken uns heute die Siegermächte ein solches Szenario auf. Das ist schlimmer als alle Demontagen.
- Vorhang! -

4. Bild
Das Foyer
Die Kulisse zeigt eine große Doppelglastür und links von der Tür befindet sich ein Pförtnerhäuschen, in dem ein Mann, einfach gekleidet mit Tuchhose, Hemd und darüber Pullover, sitzt und Zeitung liest. Heidrun erscheint und versucht, die Tür zu öffnen.
Pförtner: Heh, Fräulein, wo wollen sie denn hin? Da erreichen sie niemanden mehr. Die Tür ist verriegelt.
Heidrun: Im Rathaus befinden sich aber noch zwei Personen, die ich sprechen möchte. Können sie nicht noch einmal aufsperren?
Pförtner: Nein, das darf ich nicht. Der Amtsleiter vom Sozialamt ordnete höchstpersönlich an, dass für niemanden mehr geöffnet wird.
Heidrun: Gut, warte ich eben vor der Türe.
Neugierig kommt der Pförtner aus seinem Häuschen und betrachtet die Frau.
Pförtner: Sag mal, du bist doch das Fräulein, das zweimal die Polizei abholte?
Heidrun: Zutreffend!
Pförtner: Dann scher dich mal augenblicklich vom Acker, bevor dich wieder die Schutzleute einsacken. Hähä! Mehrzahl von Turm: türme! Kapito?
Heidrun: Duzen sie hier jeden Rathausbesucher?
Pförtner: Du machst mir Spaß: Sich mit der Obrigkeit anlegen und obendrauf noch schnoddrig sein.
Heidrun: Entschuldigung! Ich lege mich mit dieser sogenannten Obrigkeit aus Gründen an, die sie nicht kennen und weshalb ihnen auch nicht ein Urteil zusteht. Und ungebührlich verhalten nur sie sich, denn ich beachte sehr wohl im Gespräch mit ihnen allgemein gültige Umgangsformen, währenddessen sie mich unaufgefordert duzen. Ich verbitte mir solche Vertraulichkeiten. Dann rufen sie nach mir mit Fräulein, als sei ich die Bedienung in einer Kaschemme. Begrüßte ich sie als Herrlein?
Pförtner: Dir stopfen sie noch früh genug das vorlaute Mundwerk.
Heidrun: Dieses Rathaus scheint förmlich eine Brutstätte für Benehmen und Höflichkeit zu sein. Erführe Herr Knigge vom hiesigen Anstand, würde er nicht mehr auf seiner Harfe klimpern und sich jäh von seiner Lieblingswolke zu uns hinabschwingen.
Oh Zapperlot, wer naht denn da? Sieht aus, wie meine hochgeschätzte Chefin. Rein zufällig lenkt sie ihren Schritt nicht hierher. Ob ihr ein Vögelchen ein Liedlein von meiner kleinen Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt zuzwitscherte? Dieser Bodyguard begleitet sie augenscheinlich. Frau Becker pressiert es aber mächtig, mir meine Papiere zu verpassen, wenn sie sich deswegen extra herbemüht. Oh je, heute endet der Tag scheinbar, wie er begann: denkbar beschissen.
Eine Frau im Mantel und ein Mann betreten das Rathausfoyer und gehen zielgerichtet auf die Pflegerin zu. Der Mann ist sehr konservativ mit Anzug und Krawatte unter dem offenen Trenchcoat und Hut bekleidet, unter dem Arm eine Aktentasche.
Frau Becker: Heidrun, Kind, was machst du denn bloß? Als du anriefst, ich muss eine Vertretung zu deinen Patienten schicken, du meldest dich später und erklärst dann alles, dachte ich, du hättest einen kleinen harmlosen Unfall oder seist plötzlich kränkelnd. Warum sagtest du mir nicht, in welchen Schwierigkeiten du steckst? Hätten die Polizeibeamten mich nicht informiert, würde ich immer noch im Tal der Ahnungslosen wandeln.
Heidrun: Weil ich dachte, dass sie es mir sofort verbieten, Frau Kowalskis Geld einzutreiben.
Frau Becker: Allerdings, wenn es dermaßen ausufert. Wie kannst du dich nur in eine solche Gefahr begeben?
Heidrun: Ahne ich, dass ein Besuch des Sozialamtes gefährlich ist?
Frau Becker: Ach so, darf ich vorstellen: Herr Möller, unser Rechtsanwalt. Den verständigte ich gleich nach diesen Horrornachrichten und freundlicherweise kam er auch sofort mit.
Heidrun: Zum kündigen benötigen sie einen Rechtsbeistand?
Frau Becker: Wieso kündigen? Ach du meinst, ich will dir kündigen? Du spinnst wohl! Offensichtlich verwirren dir die heutigen Ereignisse vollends den Verstand. Der Teufel müsste mich reiten, wenn ich meine beste Pflegekraft rausschmeiße. Zugegeben, deine Methoden sind manchesmal schon recht ungewöhnlich und eigenwillig, aber deine Patienten bliesen wohl zum offenen Kampfe, wenn ich dich vor die Türe setze. Was ist......
Herr Möller: Moment Frau Becker, Moment. Ich weiß ja um ihre Besorgnis um ihre Angestellte, aber ich müsste im Vorfeld einige Dinge mit ihr klären.
Der 3. und der 4.Polizeibeamte und eine Frau kommen auf die Bühne und gehen zu den anderen drei Personen.
Frau Brand: Hallo, Frau Becker! Ich kehre gerade mit den beiden Herren von Frau Kowalski zurück. Es entspricht alles der Richtigkeit.
Ein weiterer Mann betritt das Foyer und geht zu der Gruppe. Seine Kleidung ähnelt der des Rechtsanwaltes.
Ach Herr Salomon, gut dass sie kommen. Ich sagte eben schon zu Frau Becker, dass alles der Richtigkeit entspricht. Die alte Dame war ja ganz außer sich, als ich mit den Polizeibeamten aufkreuzte und befürchtete schon, dass die Pflegerin veranlasste, sie aus der Wohnung zwangsweise in ein Altersheim umzusiedeln. Da konnte ich sie aber schnell beruhigen. Dann weinte sie fast, als sie hörte, dass sich die Pflegerin um ihretwillen zusammenschlagen ließ.
Heidrun: Hey, hey, Stop mal, mich schlug keiner zusammen.
Frau Brand: Ach sie sind die Schwester, der Stein des Anstoßes in vielerlei Hinsicht? Na, die Polizisten warfen sie doch die Treppe herunter? Oder nicht?
Heidrun: Doch! Trotzdem gibt es ihnen nicht das Recht, es der alten Dame zu erzählen. Soll sie sich ängstigen oder vor Schreck einen Herzinfarkt erleiden? Wer sind sie eigentlich, dass sie sich in meine Angelegenheiten mischen?
Frau Brand: Ach entschuldigen sie, meine Liebe. Brand, Frau Brand vom Volksblatt. Machen sie sich mal keine Sorgen um ihre Patientin. Dieser nette Polizeibeamte rief sofort seine Frau an und die erschien auch unverzüglich mit einer Tasche voller Nahrungsmittel bei der alten Dame und kümmert sich um sie. Das ist ja ein dolles Ding, ein dolles Ding ist das. Die Titelseite sehe ich schon direkt vor Augen.
Herr Salomon: Frau Brand, lassen sie uns in aller Ruhe die Angelegenheit klären? Außerdem sollten schon alle Betroffenen zur Sache gehört werden.
Frau Brand: Lieber Bürgermeister Salomon. Ich schätze sie und ihre Arbeit außerordentlich, aber......
Herr Salomon: Ich sehe gerade die Herren vom Sozialamt wie bestellt die Treppe herunterlaufen. Gleich hören wir, wie sie sich zu den Vorwürfen äußern.
Herr Meyer und Herr Schulze kommen hinter der Tür zum Vorschein und schließen die Tür auf. Sofort erkennen sie Frau Dreyer und den Bürgermeister.
Herr Meyer: Gut, dass sie da sind, Herr Salomon. Diese penetrante Kanaille...
Frau Becker: Wie wagen sie es, meine Angestellte zu bezeichnen?
Herr Möller: Ganz ruhig, Frau Becker, ganz ruhig. So etwas wird gerichtlich geklärt.
Frau Brand: So, Herr Salomon! Haben wir unter Bürgernähe zu verstehen, die sie zu ihrer Wahl versprachen, dass Angestellte ihrer Behörde den Bürgern zu nahe treten?
Herr Salomon: Ich versichere, dass dieser Ton sonst unüblich und von mir unerwünscht ist. Herr Meyer! Was fällt ihnen ein, dermaßen abwertend über die junge Frau zu reden?
Herr Meyer: Entschuldigung Herr Salomon, aber zweimal benötigten wir heute schon die Unterstützung von Polizeikräften, da diese Person sich ungebührlich in unseren Amtsräumen aufführte. Da verhielten wir uns ausgesprochen korrekt, nicht wahr Schulz? Aber irgendwann reißt auch dem Duldsamsten mal der Faden und dann lässt man sich schon mal ausnahmsweise zu unüberlegten Äußerungen hinreißen.
3. Polizeibeamter: Eine Unverschämtheit! Korrektes Verhalten? In der kurzen Zeit, die mein Kollege und ich in ihrem Büro weilten, beschimpften sie wie ein Rohrspatz ununterbrochen die Schwester, sodass wir sie mehrmals nachhaltig verwarnten.
4. Polizeibeamter: Würden wir bei den größten Straßenkrawallen, wenn wir um die eigene Gesundheit fürchten, verbal derartig entgleisen, füllten unsere Äußerungen landauf, landab sämtliche Zeitungen.
Heidrun: Ganz zu schweigen davon, was sie mir alles ohne Zeugen an den Kopf warfen. An einem einzigen Tage vervollständigten sie mein privates Schimpfwörterlexikon hinreichend für zehn Jahre. Oder die Tatsache, dass ein Herr Schulz gedachte, mein Anliegen dafür zu missbrauchen, sich ein privates Techtelmechtel zu verschaffen. Ich möchte nicht wissen, wieviele Bittstellerinnen auf diesem Amt, unverschuldet in eine Notlage geraten und dadurch in Abhängigkeit, seine Obszönitäten und Buhlerei ertragen mussten.
Herr Schulz: Glatte Unterstellungen! Alles Lügen!
Heidrun: Sagte die Mafia, kurz bevor sie den Richter erschoss.
Herr Salomon: Das reicht! Ein Untersuchungsausschuss wird objektiv die Vorwürfe aufklären. Solange gelten sie beide, meine Herren, als suspendiert. Danke! Sie können gehen.
Herr Meyer: Aber Herr Salomon, sie......
Herr Salomon: Ruhe! Verschwinden sie mir aus meinem Blickfeld. Ihre heutigen Verfehlungen vernichten jahrelange Arbeit, um das Vertrauen der Bürger in die öffentliche Hand wiederzugewinnen. Adios, meine Herren! Herr Schmidt!
Pförtner: Ja, bitte, Herr Salomon!
Herr Salomon: Weilt Herr Klingbeil noch im Hause.
Pförtner: Meines Wissens nach ja!
Heidrun: Einen Augenblick bitte, Herr Pförtner Schmidt! Erklären sie bitte dem Bürgermeister, weshalb sie Rathausbesucher gegen ihren erklärten Willen duzen oder ihnen das Maul stopfen wollen, um sie zu zitieren!
Herr Salomon: Wie bitte? Sind denn hier alle durchgeknallt?
Pförtner: Na...! Ich...! Wissen sie...?
Herr Salomon: Ich verwandte mich letztes Jahr persönlich für sie, Schmidt, damit sie hier weiter an der Pforte ihren Dienst verrichten dürfen. Ich erwartete von ihnen keinen Dank, aber auch nicht, dass sie dergestalt unser Rathaus präsentieren.
Heidrun: Im Verhältnis zu Herrn Schulz und Herrn Meyer benahm er sich noch relativ harmlos. Ihr Pförtner zeigte nur deutlichst, woran das Berufsbeamtentum krankt: die Radfahrermentalität. Nach oben buckeln, nach unten treten. Innerhalb ihres kleinen Bereiches spielen sie alle Absolutisten, die ihren Mitbürgern ihre totale Macht beweisen. Wer die Macht nicht anerkennt, wird wie eine Kellerassel zertreten.
Herr Salomon: Ich konnte mich noch nie über einen Beamten beklagen.
Heidrun: Das glaube ich ihnen aufs Wort Herr Salomon. Gehen wir beispielsweise gemeinsam zur Post. Sie, Herr Salomon, als einflussreiches hohes Tier, erhalten augenblicklich ihre Briefmarke notfalls kostenlos und vorgeleckt mit drei Bücklingen an der aufgehaltenen Tür. Ich, die kleine Bürgerin, stehe vor dem leeren Schalter und werde genötigt, geduldig abzuwarten, bis der Beamte sein Kreuzworträtsel gelöst, die Stullen beiseite geräumt und die Thermoskanne verschlossen hat. Erst dann knallt er mir gnädigerweise ebenfalls eine Briefmarke unwirsch auf den Thresen. Normalerweise ignoriere ich ein Fehlbetragen wie das ihres Pförtners, man gewöhnt sich an alles und es lohnt einfach nicht, sich alltäglich aufzureiben.
Herr Salomon: Ein Grund mehr für unerbittliche Strenge!
Heidrun: Schmeißen sie Einzelne raus, die den Bogen überspannten, ändert sich grundsätzlich dennoch nichts. Gut, die Mentalität findet man auch in anderen Berufsgruppen. Aber die Beamten in ihren herrlich sicheren Pöstchen mit dem Wissen, dass ihnen kein Nachteil erwächst und am Ende die sichere Pension winkt, egal, ob und wieviel sie leisteten, dass fördert den Machtmissbrauch und nur wenige rühmliche Ausnahmen schalten bei Dienstantritt nicht ihr Hirn ab, zeigen Moral und Eigenverantwortung. Sonst hätten möglicherweise die anwesenden Polizeibeamte auch nicht reagiert und wären auf den Wagen von Herrn Schulz und Herrn Meyer, der einfachheithalber, ebenfalls aufgesprungen. Dann stünde es aber schlecht um mich und erst recht um Frau Kowalski, alt und arm gewissermaßen der Steiß der Gesellschaft. Der Pförtner ist, Verzeihung, ein armes Würstchen, ungeeignet, um ein Exempel zu statuieren.
Herr Salomon: Sie mögen Recht haben, aber wie sollte ich daran etwas ändern? Abschaffung des Beamtentums? Dazu reichen auch meine Befugnisse nicht aus. Wenn ich jetzt nicht knüppelhart durchgreife und die ganze Geschichte hier publik wird, kostet es mich zur Wahl etliche Stimmen.
Frau Brand: Es wird publik, Herr Bürgermeister. Darauf können sie sich verlassen. Solch einen Skandal verheimliche ich nicht meinen Lesern. Aber erlauben sie mir eine Frage: sorgen sie sich um die nächste Wahl oder um das Wohl der Bürger?
Herr Salomon: Um beides, Frau Brand, um beides. Denn nach meiner Abwahl kann ich mich nicht mehr für die Belange unserer Einwohner einsetzen.
Heidrun: Frau Brand, ich bedanke mich selbstverständlich für ihr Engagement. Und ich bedaure es ganz doll, ausgerechnet einem Politiker zur Seite springen zu müssen. Aber bedenken sie, was sie anrichten, wenn sie im Volksblatt breit über die heutigen Ereignisse berichten. Gut, sie haben ihre Story. Doch auch ohne ihren Artikel sind die Behörden bei der Bevölkerung herbe in der Kritik. Viele alte Menschen lesen ihre Zeitung, die sich kaum hertrauen, weil sie sich wie Almosenempfänger fühlen, wenn sie die ihnen zustehenden Leistungen beanspruchen. Mit den von ihnen geplanten Zeilen hauen sie noch weiter in diese Kerben und bestätigen die Furcht der Alten. Das fördert letztendlich viele Frau Kowalskis, die lieber ihre erbärmliche Lebenslage ertragen, als sich dem Schreckgespenst einer Behörde zu stellen.
Frau Brand: Aber liebes Kind! Ich kann doch zu den Vorfällen nicht schweigen. Dann zieht man kaum die Verantwortlichen zur Rechenschaft.
Herr Möller: Mit der Unterstützung der Presse gelänge es leicht, ihre Anzeige wegen Hausfriedensbruch aus der Welt zu schaffen.
Herr Salomon: Herr...
Herr Möller: Möller, gestatten Herr Möller. Rechtsbeistand der Sozialstation. Frau Becker alarmierte mich, als sie erfuhr, dass ihrer Pflegekraft eine Vorstrafe droht.
Herr Salomon: Herr Möller. Die Anzeige wegen Hausfriedensbruch nehme ich selbstverständlich zurück.
3. Polizeibeamter: Wir .......
Herr Möller: Verzeihung! Die sie aber nicht erstatteten. Ziehen ihre Beschäftigten die Anzeige zurück oder bestehen sie vielleicht weiter aus Rachegefühlen darauf.
3. Polizeibeamter: Darf ich.......
Herr Salomon: Im Dienst dürfen Herr Meyer und Herr Schulz als Privatpersonen keine rechtlichen Schritte eigenmächtig im Namen der Behörde unternehmen ohne Absprache und Absegnung der entsprechenden Gremien. Hier verstießen sie bereits gegen interne Regelungen und überschritten ihre Kompetenzen. Oberster Hausherr bin ich und ich entscheide letztendlich über einen Widerruf der Anzeige.
3. Polizeibeamter: Darf ich jetzt auch mal was sagen? Wir schrieben keine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, denn wir rochen sofort den Braten, dass etwas nicht stimmt.
Herr Möller: Da bleibt noch der Tatbestand der groben Beleidigung.
Herr Salomon: Selbstverständlich verantworten sich die Beschuldigten in einem Disziplinarverfahren. Ich lege wirklich keinen gesteigerten Wert auf eine zivilgerichtliche Auseinandersetzung. Werter Herr Möller! Ich bitte sie um eine gütliche Einigung. Vertrauen sie mir, dass wir die Schuldigen entsprechend maßregeln.
Frau Becker: Und was geschieht mit den Polizisten, die meine Krankenschwester die Treppe hinunter warfen? Ebensogut hätte sie sich das Genick brechen können. Auch wenn sie nicht in meinem Auftrage handelte, so vertrat sie jedoch eindeutig die Interessen der Sozialstation. Muss ich nun fürchten, dass mein Personal, wenn es sich traut, sich für die Patienten einzusetzen, die weiß Gott über keine Lobby verfügen, Kopf und Kragen riskieren? Wie kann ich meiner Fürsorgepflicht gegenüber meinen Arbeitnehmern als Einsatzleiterin Rechnung tragen, wenn wildgewordene Polizisten eine Hetzjagd auf sie veranstalten?
4. Polizeibeamter: Sehr geehrte Frau Becker! Auch wir stecken in einer Polizeiuniform und beschritten beileibe nicht den Dienstweg, als wir sie und Frau Brand umgehendst informierten, was sich hier abspielt.
Frau Becker: Sie meine ich doch auch gar nicht. Sie verhielten sich, wie man es erwartet.
3. Polizeibeamter: Frau Becker. Unsere Kollegen, jung und ungestüm, verfügen trotzallem über einen guten Kern. Ihr grober Fehler bestand darin, sich von den Herren im Sozialamt aufhetzen zu lassen und in ihrer Unerfahrenheit unangemessen zu reagieren. Die Vorfälle tun uns entsetzlich leid, zumal die Schwester dabei Schaden erlitt. Dennoch bitten wir sie darum, diese Angelegenheit intern regeln zu dürfen. Uns Polizeibeamten mutet man auch ziemlich viel zu, besonders dann, wenn wir die Suppe der Politiker auslöffeln müssen. Als ich zur Polizeischule kam, glaubte ich fest an das Bild des Freundes und Helfers und nicht daran, meinen Kopf für die politischen Verfehlungen hinhalten zu müssen und obendrein zum Prügelknaben der Nation im zweiseitigen Sinne abgestempelt zu werden. Die Vorgehensweise unserer Kollegen kreidet die Öffentlichkeit nicht denen, sondern der Polizei im Gesamten pauschal an.
4. Polizeibeamter: Entspricht es ihrem Interesse, die ganze Polizeischaft in ein schlechtes Bild zu rücken? Und machen wir uns nichts vor. Einer bezeugt dem anderen, dass es sich um einen bedauerlichen Unfall handelte, die Schwester möglicherweise selbst Schuld sei, weil gestolpert. Mit allen Mitteln werden die Kollegen versuchen, nachvollziehbar, ihren Kopf irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Ich glaube, intern gibt es bessere Möglichkeiten, den Zwischenfall adäquat zu sühnen und den Heißspornen beizubringen, dass sich etwas Ähnliches nie wiederholt.
Herr Möller: Schwester Heidrun, wie fassen sie den Vorschlag auf?
Heidrun: Im Grunde genommen interessiert mich nur, dass Frau Kowalski endlich eine finanzielle Hilfe erhält. Deswegen kam ich her und nicht, um den großen Racheengel zu verkörpern.
Frau Brand: Soll ich etwa den überzogenen Polizeieinsatz auch totschweigen?
Heidrun: Frau Brand, niemand wünscht ein Totschweigen. Es geht um das Maß der Mittel, um taktisches Geplänkel, um möglichst die gesteckten Ziele zu erreichen. Berichten sie ruhig reißerisch über das Theater vor Ort, macht sich gut, verkauft sich besser und am besten nutzt es der eigenen journalistischen Karriere.
Frau Brand: Darum geht es mir nicht. Aber die Leser erwarten von mir eine umfassende Berichterstattung. Zeitungen kauft man, um sich zu informieren.
Heidrun: Schlagzeilen mangelt es an Informationen, vermitteln keine Hintergründe, da nicht spektakulär genug. Sehen sie sich kurz vor Weihnachten meine Arbeitssituation an. Üblicherweise verabreiche ich morgens sechs Insulinspritzen. In einem Bezirk mit der Größe, Bewohnerzahl und Fläche einer mittelgroßen Stadt benötige ich Wegezeiten von zwanzig bis dreißig Minuten von einem Patienten zum anderen. Das heißt, die Tour zu den Diabetikern gut einzuteilen, damit nicht nur alle pünktlich am Frühstückstisch sitzen, sondern dass auch noch ein Pläuschchen drin ist. Die meisten meiner Betreuten sind alleinstehend und verbringen überwiegend den ganzen Tag alleine in ihrer Wohnung. Häufig bin ich in den zehn Minuten morgens ihr einziger Kontakt zur Außenwelt.
Frau Brand: Da müssen sie ja fast Purzelbäume schlagen, um das Pensum zu schaffen.
Heidrun: Sie erfassen es. Inzwischen versorge ich aber vierzehn Zuckerkranke. Der Arbeitstag beginnt für mich statt der bereits sehr unchristlichen sechsten Stunde nun um vier und die Patienten, mit denen ich die Leidenschaft des Ausschlafens teile, stehen zwangsweise wie ich vor dem Wecken auf. Da ist nichts mehr mit Morgenstund´ hat Gold im Mund, denn bevor meine Patienten diesen aufbekommen, um meinen Gruß zu erwidern, bin ich schon wieder lange weg. Endlich arbeite ich, wie es die Krankenkassen fordern, denn die finanzieren ausschließlich den Piekser und nicht irgendein Geschwätz. Meine Waschpatienten dürfen dagegen bis in die Puppen schlafen, denn der Letzte kommt erst mittags in den Genuss der morgendlichen Körperhygiene und aus dem Bett.
Herr Salomon: Derartige Missstände gehören unverzüglich abgestellt. Dann müssen die Krankenkassen auch die soziale Betreuung abrechnen, die gehört doch dazu. Und weshalb stellt man nicht weitere Schwestern bei dieser extremen Überbelastung ein?
Heidrun: Die Krankenkassen halsen sich keine Kosten für Menschen auf, die die Gesellschaft als Belastung ansieht. Und sie vergessen eine Kleinigkeit. Fragen sie bitte den Polizeibeamten, wie er auf eine erneute Erhöhung der Krankenkassenbeiträge reagiert.
3. Polizeibeamter: Klar wie Kloßbrühe! Sauer!
Heidrun: Oho! Er zahlt aber Krankenkassenbeiträge! Mit wem verdirbt es sich die Krankenkasse wohl lieber? Frau Becker, erklären sie bitte, warum sie keine weiteren Pflegekräfte einstellen.
Frau Becker: Versierte Hauskrankenpflegekräfte sind eine seltene Spezie und auf vierzig offene Stellen bewirbt sich gerade eine ausreichend qualifizierte Kraft. Seit Monaten versuche ich, vier Planstellen zu besetzen und mein schlechtes Gewissen frisst mich fast auf, wenn ich meinen überarbeiteten, müden Mädchen noch eine zusätzliche Pflege aufbrumme. Mir bleiben nur Durchhalteparolen und die Hoffnung, durch eine Neueinstellung wieder in ihrer Gunst zu steigen.
Heidrun: Krankenhäuser klagen über Personalmangel und Krankenschwestern über die fehlende Akzeptanz ihrer Arbeit und unangemessenen Bezahlung. Was sollen wir da erst sagen, wo wir uns in den eigenen Reihen gegen das Image als bessere Putzfrauen wehren. Nur jede Putzfrau bei unseren Alten verdient schwarz netto unseren Bruttolohn. Herr Salomon verurteilte sofort die Missstände. Sie sehen, Frau Brand, wie schnell man selber Dreck am Stecken bekommt trotz aller Bemühungen, Einsicht, persönlichem Einsatz. Ich empfände es als schreiende Ungerechtigkeit, würde morgen in ihrer Zeitung der sensationelle Aufmacher verkünden, Hauskrankenpflegerinnen behandeln alte Menschen lieblos, weil sie sich keine Zeit für ihre Patienten nehmen.
Frau Brand: Na, unter journalistischer Tätigkeit verstehe ich schon exaktere Recherchen.
Heidrun: Es ehrt sie, aber es reicht nicht. Ein weiteres Problem sind viele meiner Neupatienten, die sich wochen-, manchmal monatelang in stationärer Behandlung befanden. In den Wohnungen herrscht die muffige Kühle des Verlassenseins, kein Tannengrün, kein Rauscheengel, kein Adventsgesteck zeugen von dem nahenden Weihnachtsfest. Ein Körper gesundet nicht mit einer kranken Seele. So gehört zu meiner Notausrüstung im Kofferraum nicht nur die Erste-Hilfe-Tasche mit Verbandsmaterial, Spritzen, Tupfer, Alkohol und was man so alles braucht, sondern auch weihnachtliches Naschwerk, Stollen oder Fichtenzweige. Es geht mir nicht um das Geld. Ich gebe und teile gerne. Aber warum ich alleine? Frau Brand, gehen sie zu ihrem Chef und schenken ihm ein Teil ihres Gehaltes zurück?
Frau Brand: Ganz gewiss nicht! Einen Vogel würde ich dem zeigen, der mir ein solches Anliegen offeriert.
Heidrun: Sie verdienen mit Sicherheit mehr als ich. Ich tue es, weil ich doof bin. Was wieder einmal beweist: der unsozialste aller Berufe ist der soziale Beruf.
Frau Brand: Etwas frostig formuliert!
Heidrun: Keineswegs! Wir sitzen mang den Stühlen und müssen die Gleichgültigkeit unserer Mitmenschen ausbaden. Warum achten nicht Nachbarn oder Bekannte darauf, warum entwickeln nicht alle mehr Verantwortung füreinander? Die kommen ungeschoren davon, aber einen Einzelnen Fehlverhalten zu beweisen und anzuprangern, ist leicht.
Frau Brand: Unsere Gesellschaft verhält sich eben nicht anders. Soll ich das System verändern?
Heidrun: Was nutzt ein neues System, wenn sich der Mensch nicht ändert? Da genügt ein Blick über die Grenze. Ein neues System! Mit vielen, vielen Radieschen. Und schneiden wir manch ein Radieschen auf mit der Befürchtung, auch dieses sei innen nur weiß, wie groß der Schreck, dass etliche innen sogar tiefbraun sind. Ein neues System! Mit teilweise wirklich guten Ideen! Und jeder Grepo, der an der Grenze einhundertfünfzig Prozent seinen Dienst verrichtet und mit der größtmöglichen Kleinlichkeit die Grenzgänger schikaniert, beweist deutlichst, dass ein neues System alleine nichts richtet. Er könnte ebensogut ohne aufzufallen bei Nazis Grenzen kontrollieren. Sie mit ihrer Zeitung sitzen an dem Hebel, das Bewusstsein der Leute füreinander zu entwickeln und zu schärfen, ohne auf die Barrikaden zu rufen, um dann den Gerufenen in den Rücken zu fallen, wie es ein Herr Luther oder ein Herr Ebert oder ganz viele Andere taten.
Frau Brand: Ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Wir werden mal in aller Ruhe ein Käffchen miteinander trinken und weiterplaudern.
Heidrun: Dieses richtig nette Angebot weise ich nicht ab.
Herr Möller: Also läutern sich alle Dinge ohne meine Mithilfe? Dann empfehle ich mich, denn ich hätte noch andere Verpflichtungen.
Frau Becker: Ja, Herr Möller. Falls noch Schwierigkeiten auftreten, setze ich sie eilends in Kenntnis.
Herr Möller: Auf Wiedersehen, meine Herrschaften.
Herr Möller lüftet seinen Hut und verläßt den Schauplatz.
Alle Anwesenden: Auf Wiedersehen!
Heidrun: Und was geschieht mit Frau Kowalski?
Herr Salomon: Ach so ja! Herr Klingbeil wird das Nötige für eine sofortige Auszahlung als Ersthilfe für die Feiertage in die Wege leiten und später eine korrekte Berechnung ihrer Ansprüche vornehmen. Ich selber besitze auch keine fachliche Kompetenz in dieser Frage.
Heidrun: Gut, dann marschieren wir nach oben?
Die Pflegekraft dreht sich in Richtung Tür, als Frau Becker sie am Ärmel festhält.
Frau Becker: Du hast ausmarschiert, Schätzchen. Wir fahren erst zum Betriebsarzt und lassen die Folgen deines Treppensturzes untersuchen. Das ist ein Arbeitsunfall, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie ich den plausibel der Berufsgenossenschaft erkläre.
Heidrun: Und wer bringt Frau Kowalski das Geld?
3. Polizeibeamter: Meine Frau versorgt sie doch gerade mit allem Notwendigen. Da kommt es auf eine Stunde nicht mehr an.
Frau Brand: Ansonsten überbringe ich ihr mit Freuden das unverhoffte Weihnachtsgeld. Sorgen sie erstmal dafür, dass sich unsere kleine Heldin auskuriert.
Heidrun: Das mit der Heldin mag ich nicht. Helden zittern nicht die Hände, Helden schlottern nicht die Kniee und Helden sterben heldenhaft. Ich hänge am Leben.
Frau Brand: Okay! Nennen wir es Zivilcourage! Wenige hätten sich ein zweites Mal in die Höhle des Löwen gewagt.
Frau Becker: Stimmt! Ich wäre sofort geflitzt. Wenn sich die Angelegenheit ohne uns regeln lässt, verabschieden wir uns.
Herr Salomon: Das läuft jetzt in sicheren Bahnen, Frau Becker. Ach, Frau – wie war ihr werter Name?
Heidrun: Frau Dreyer!
Herr Salomon: Frau Dreyer, meiner Partei fehlen Sozialpolitiker.
Heidrun: Ach nein! Lassen sie es mal gut sein. Ich leiste mir lieber meine eigene Politik. Vor einem Parteikarren gespannt müsste ich unter Umständen im Rahmen der Parteidisziplin Dinge vertreten, die mir nicht behagen. Solange ich keinem Verein angehöre, kann ich meine Hiebe überall hin verteilen.
Frau Becker: Genug! Heute verteilst du keine Hiebe mehr, sondern lässt deine Blessuren erstmal behandeln. Los komm!
Heidrun: Ich kann mich darauf verlassen, dass für Frau Kowalski gesorgt wird?
Herr Salomon: Ehrenwort!
Frau Brand: Sollten sie am Ehrenwort eines Politikers zweifeln, bin ich auch noch da. Dann rollt doch noch die journalistische Springflut an.
Alle Anwesenden: Aufwiedersehen!
Frau Becker und Heidrun verlassen unterhaltend das Foyer in die Richtung, aus der sie kamen, ebenso die Polizeibeamten, doch teilen sich ihre Wege nach rechts und nach links. Herr Salomon und Frau Brand treten durch die Glastür in das Innere des Rathauses.
3. Polizeibeamter: Mann, was schreiben wir denn auf dem Revier in den Bericht.
4. Polizeibeamter: Oh je! Das Schlimmste besteht uns noch bevor.
Frau Becker: Heidrun, bevor du noch einmal so einen Alleingang unternimmst, wendest du dich ersteinmal vertrauensvoll an mich. Vielleicht bin ich nicht ganz verbohrt oder dumm? Die Geschichte heute hätte böse ins Auge gehen können. Meine Güte, mir ist ganz schlecht vor Aufregung.
5. Bild
Heilig Abend
Bühnenbild wie im ersten Bild, doch die Decken vor dem Wohnzimmerfenster fehlen. Im erleuchteten Zimmer steht ein Weihnachtsbaum, der gerade vom 1. und 2. Polizisten geschmückt wird. Aus einem Radio, was vorher nicht im Wohnzimmer stand, erklingt leise Weihnachtsmusik und zusätzlich steht vor dem Fenster ein Schaukelstuhl. Auf dem Tisch liegt eine Tischdecke und darauf steht ein Korb mit Früchten. Insgesamt vermittelt das Zimmer einen freundlichen Eindruck. Die Pflegerin steht vor der Wohnungstür und klingelt.
Heidrun: Ach so, die Klingel funktioniert ja nicht.
Sie klopft an die Tür, als der 3. Polizist breit grinsend schnell die Tür öffnet.
Ach nein! Lange nicht gesehn und doch wiedererkannt.
3. Polizeibeamter: Wieso klopfst du denn, Karbolmäuschen? Ich habe dein Klingeln gehört.
Heidrun: Die Klingel funktioniert doch nicht ohne Strom.
3. Polizeibeamter: Ja sag mal, merkst du nichts?
Die Pflegerin drückt noch einmal auf den Klingelknopf.
Heidrun: Doch! Es klingelt!
3. Polizeibeamter: Ja, aber anscheinend nicht bei dir.
Heidrun: Heller Flur! Licht! Strom!
3. Polizeibeamter: Na endlich! Der Groschen fiel aber pfennigweise.
Heidrun: Wie habt ihr das denn fertig gekriegt?
3. Polizeibeamter: Na – es kommt noch besser!
Mit einer theatralisch weit ausladenden Geste und Bückling bittet der 3. Polizist die Pflegerin in die Wohnung.
Treten sie ein, gnädige Frau, in diesen bescheidenen Pallaste! Darf ich ihnen die Tasche abnehmen und vorraustragen? Zum Thronsaal bitte geradeaus.
Heidrun betritt die Wohnung und beide gelangen, der 3. Polizist voran, ins Wohnzimmer, in dem der 1. und 2. Polizist intensiv den Baum schmücken, fast mit ihren Köpfen dabei in den Baum verschwindend. Die Pflegerin erkennt sie trotzdem sofort und bleibt auf der Wohnzimmerschwelle stehen. Ihr bisheriger fröhlicher Gesichtsausdruck wird eisig.
Heidrun: Oh, die auch hier! Verhaften die Jungbullen den Weihnachtsbaum wegen revolutionärer Untriebe?
Der 1. Polizist dreht sich zu ihr um und ist sichtlich verlegen.
1. Polizeibeamter: Wir putzten die Fenster und reinigten die Böden und brühten für Frau Kowalski Tee und beim Baumschmücken......
Der 3.Polizeibeamter, der inzwischen zu ihm ging, gibt ihm einen leichten Klaps auf den Hinterkopf.
3. Polizeibeamter: Was macht man, wenn man hochgradig Mist gebaut hat, du Hirni?
1. Polizeibeamter: Entschuldigen sie bitte vielmals!
Daraufhin zeigt auch der 2. Polizeibeamte sein Gesicht, freilich nicht die sichere Deckung verlassend, die ihm der Baum bietet.
2. Polizeibeamter: Verzeihung! Tut es noch sehr weh?
Die Pflegerin schiebt seitlich ihren Pullover etwas hoch und drückt das Hosenbund herunter und entblößt somit Taille und einen Teil der Hüfte. Ein riesiges Hämatom wird sichtbar.
Heidrun: Na hier, schau mal! Einen tellergroßen Bluterguß in sämtlichen Farben schillernd. Der zieht sich über den Hintern bis zum Oberschenkel herunter.
2. Polizeibeamter: Es tut uns leid.
Die Pflegerin mit immer noch verärgertem Gesichtsausdruck ordnet ihre Kleidung.
Heidrun: Okay! Schwamm drüber!
3. Polizeibeamter: Oh, Karbolmäuschen! Zeig uns mal, wo der blaue Fleck endet.
Heidrun: Schnauze!
3. Polizeibeamter: Da hast du ein R vergessen.
Heidrun: Wie bitte?
3. Polizeibeamter: Du hast ein R vergessen. Schnauzer. Ich heiße Erich Schnauzer.
Heidrun: Na dufte! Soll ich darüber lachen?
3. Polizeibeamter: Sei nicht vergrätzt. Die Kollegen versuchten immerhin, etwas gutzumachen. Nahmen dir deine Arbeit ab und brachten hier alles auf Vordermann.
Heidrun sieht sich im Zimmer um und stellt anerkennend fest, dass es sich wirklich propper veränderte. Dennoch bleibt sie leicht gereizt.
Heidrun: Sehr reizend, aber nicht meine Aufgabe. Ich bin examinierte Krankenschwester und somit eine Hauskrankenpflegerin, Betonung auf kranken, also zuständig für die Pflege und medizinische Versorgung. Die Hauspflegerinnen verrichten hauswirtschaftliche Tätigkeiten, übernehmen Besorgungen und Einkäufe, in der Regel un- oder kurzfristig angelernte Hilfskräfte. Macht euch nichts daraus. Die Krankenhäuser kapieren den Unterschied auch nicht, versprechen den Alten eine Haushaltshilfe, weil sie sie unbedingt loswerden wollen und verschreiben Hauskrankenpflege. Ein ständiges Ärgernis! Uns hängen dann endlose Dispute am Hals, da die Patienten nicht begreifen, wieso die angekündigte Putzfrau dreijährig ausgebildet, ein Examen vorweisen kann und gar nicht daran denkt, die Böden zu schrubben. Ihr erledigt also Frau Kowalskis Aufgabe. Denn rüstig genug vermag sie ihren Haushalt alleine versorgen und niemand verordnete ihr eine Hauspflege. Wozu man ihr die Hauskrankenpflege verschrieb, bleibt allerdings auch ein Geheimnis, denn eigentlich umfasst unsere Ausbildung keine Kampfeinsätze bei Sozialbehörden. Vielleicht übernehmen die Lehrpläne der Krankenpflegeschulen zukünftig ein neues Unterrichtsfach: passiver Widerstand oder ziviler Ungehorsam.
3. Polizeibeamter: Eih Klasse! Da bewerben wir uns gleich als Sparringspartner. Nun ziehe nicht so ein langes Gesicht. Die Kollegen mühten sich redlich und opferten am Wochenende und heute jede freie Minute.
Heidrun: Die alte Dame freut es sicher und solange ich die beiden nicht vor lauter Begeisterung und Dankbarkeit knutschen muss, akzeptiere ich ihre Kapitulation mit diesen Reparationsleistungen.
3. Polizeibeamter: Niemand erwartet von dir, dass du mit ihnen gleich Brüderschaft trinkst. Heute Abend ist Heilige Nacht. Krönen wir sie mit einer Versöhnung und einer Friedenspfeife. Zigarette gefällig?
Der 3. Polizist bietet den Dreien aus seiner Zigarettenschachtel Zigaretten an. Auch die jungen Polizisten greifen zu und man bemerkt ihre Erleichterung, dass sich die Lage entspannt. Eilfertig gibt der 2. Polizist Heidrun Feuer, die sich bemüht, nicht allzu strafend zu gucken.
Heidrun: Danke!
3. Polizeibeamter: Möchtest du Kaffee, möchtest du Tee?
Heidrun: Einen Kaffee könnte ich schon vertragen.
3. Polizeibeamter: Mädchen, der Mustopf, in dem du steckst, gleicht in der Größe dem Müggelsee. Bist du ein Spätzünder! Heiß oder kalt?
Heidrun: Logischerweise heiß!
3. Polizeibeamter: Spätzünder! Zünder! Zünden! Was zündet man denn an?
Heidrun: Gas!
Rennt ins Badezimmer und man hört sie begeistert rufen.
Warmes Wasser! Richtiges warmes Wasser! Ein Alptraum der Gedanke, halbverschlafen sich eiskaltes Wasser in das Gesicht zu klatschen. Entweder ist man dann wach oder rutscht vor Schreck ins Koma.
Sie kommt mit erfreuterem Gesicht wieder in das Zimmer.
Toll! Spitze!
3. Polizeibeamter: Warum legst du nicht deinen Anorak ab?
Heidrun: Sag bloß, die Heizung läuft auch?
3. Polizeibeamter: Also soweit ist die Wohnung inzwischen durchgewärmt, dass auch du Tränentier bemerken müsstest, dass dir nicht mehr der Schlodder an der Nase gefriert. Heute morgen drückten sich Elektriker, Monteure und Installateure förmlich die Klinke gegenseitig in die Hand.
1. Polizeibeamter: Kaum beseitigten wir die Spuren eines Instandsetzungstrupps, putzten wir schon wieder dem zweiten hinterher.
Heidrun: Jungs, ihr seid großartig.
1. Polizeibeamter: Das Lob würden wir uns ja gerne auf die Brust heften, jedoch hieße es, sich mit fremden Federn zu schmücken.
2. Polizeibeamter: Da stocherte und hakte und wühlte und alarmierte und wirbelte offenkundig die Zeitungstante vom Volksblatt und ließ Verbindungen und Muckis in Form der Androhung eines peinlichen Berichtes in der Presse wirken.
3. Polizeibeamter: Die wuchs gewaltig über sich hinaus, ausgerechnet die schwerfällige Bewag und unwillige Gasag innerhalb von Stunden an einem solchen Tage in Bewegung zu setzen. Beweisen die doch sonst eher Schnelligkeit bei Mahnungen und beim Abstellen. Damit baute sich die Brand selber in der Berliner Historie ein Denkmal.
Heidrun: Dieser Frau zolle ich inzwischen vollste Anerkennung. Freiwillig auf das gefundene Zeitungsfraß schlechthin zu verzichten, bedeutet viel angesichts der Sensationsgeilheit nicht nur der Druckmedien. Selten genug findet man unter den Geschreibselgeiern eine ehrliche Seele, die angesichts von Zeilen- und Spaltenanzahl über genügend Gesinnung verfügt, verantwortungsbewusst zu handeln. Was sagt denn zu alledem Frau Kowalski? Wo steckt sie übrigens?
2. Polizeibeamter: Die ist restlos platt. Bei der morgendlichen Invasion der Handwerker hüpfte sie durch die Wohnung wie ein Küken, dass aus dem heimeligen Nest auf den harten Betonboden plumpste, und guckte drein, als säße vor ihr der riesige Haus- und Hofkater, der sich bereits genüsslich ob ihres hilflosen Anblickes das Maul schleckt.
1. Polizeibeamter: Wir schickten sie vorsichtshalber irgendwann ins Bett, bevor sie vor Aufregung umkippt und doch noch zu Weihnachten ein Objekt für Quacksalber und Pillendreher wird. Der ganze Trubel rüttelte reichlich an ihrer Konstitution. Seitdem schläft sie wie ein Murmeltier.
Heidrun: Wenigstens stand sie nicht alleine in dem Rummel und erfuhr Unterstützung. Die Beseitigung des Handwerkerdreckes bedeutet häufig größere Anstrengungen wie die Reparatur an sich. Tja, da sehe ich mich gezwungen, mein Bild von euch doch etwas zu korrigieren.
3. Polizeibeamter: Die Bengels erschienen heute Morgen lediglich bei Frau Kowalski, weil sie gestern ihre Tasche liegen ließen und gerieten auf diese Art in das muntere Treiben, dass die alte Dame völlig überforderte. Daraufhin ersuchten sie um einen Urlaubstag, den ich ihnen trotz Personalmangels angesichts der offenen Rechnung gewährte. So ist doch jedem mehr gedient als mit offiziellen Disziplinierungen, Gerichten mit gegenseitigem Angepisse oder verpfuschten Laufbahnen.
Heidrun: Mich brauchst du nicht agitieren, ich stimmte gestern deinem Vorschlag zu, obwohl ich ehrlicherweise ihnen lieber eins in die Fresse gehauen hätte. Ich eigne mich nicht zum Jesus und biete auch noch die andere Backe feil.
Die jungen Polizisten ziehen wieder merklich den Kopf ein.
3. Polizeibeamter: Na, wie findest du unseren Weihnachtsbaum. Schick, was? Den etwas armseligen Schmuck von Frau Kowalski peppten unsere Bubis aus eigener Tasche auf. Da flitzten sie aber, um noch was vor Ladenschluss zu erstehen.
Heidrun: Na ja! Geschmack darf man ihnen nicht absprechen.
1. Polizeibeamter: Das ist aber keine Entschädigung. Das machen wir wirklich gerne. Dabei entdeckte ich den urigen Schaukelstuhl. Mein Geschenk für Frau Kowalski zu Weihnachten. Ob der ihr gefällt?
Heidrun: Sicherlich, wenn er so gemütlich ist, wie er aussieht.
3. Polizeibeamter: Unser Waisenknabe, nein, nein, ganz real, fand in Frau Kowalski augenscheinlich eine Art Ersatzoma. Auch sie schloss den Flegel gleich ins Herz, quasi gegenseitige Liebe auf den ersten Blick. Vielverheißend für die Zukunft! Möglicherweise bekommt sie den Rohdiamanten noch geschliffen. Apropos Erziehung! Unser Revier entschied, dass jeder unserer Beamten einen Obulus in ein Sparschwein steckt, der pauschal und polemisch Mitbürger beschimpft. Also wenn zum Beispiel die Demo-Sanitäter wieder studentische Krawallmacher unterstützen und deswegen als rote Brandstifter verunglimpft...
2. Polizeibeamter: Erich, das kostet dich eine Mark.
3. Polizeibeamter: Wieso denn? Das war doch nur ein Beispiel!
2. Polizeibeamter: Ja! Aber nicht die studentischen Krawallmacher! Nix da. Eine Mark in das Schwein.
Heidrun zückt ihr Portemonnaie aus der Tasche und fischt ein Markstück heraus und reicht es dem 3. Polizisten.
Heidrun: Hier hast du von mir eine Mark dazu.
3. Polizeibeamter: Wofür?
Heidrun: Wenn die Bengels von der Polizeischule, die nicht nur an der Uniform grün sind, sondern hauptsächlich hinter den Ohren, auf Demos eingesetzt werden, sind Krawalle nicht mehr zu vermeiden, egal, wie friedfertig oder gewaltbereit eine Demo auch auftritt. Und dann verhindern speziell die Sanis der roten Hilfe unter Umständen größere Katastrophen.
3. Polizeibeamter: Ich kann nicht wechseln.
Heidrun: Wieso wechseln?
3. Polizeibeamter: Die Aussage kostet nur fünfzig Pfennig.
Heidrun: Nimm den Rest als großzügige Spende.
3. Polizeibeamter: Handelt es sich hierbei um den Versuch einer Beamtenbestechung?
Heidrun: Nein! Auf Demos trifft man ja genug Leute, denen es wirklich nur um Randale geht und ehrliche Demonstranten in Misskredit bringen. Nur müssen es nicht unbedingt Studenten sein. Also spendest du doch auch fünfzig Pfennig und ich folge mit meinem Rest deinem Beispiel.
3. Polizeibeamter: Dann verrate ich dir, was mit deiner Mark passiert. Dieses Sparschwein schlachten wir nächstes Jahr Anfang Dezember. Sein Inneres erhält Frau Brand für ihre neue Initiative: Bürger helfen Bürgern. Wenn du nächstes Jahr wieder an so ein armes Hascherl gerätst, in der Adventszeit frisch aus dem Krankenhaus entlassen und kahle Bude, plünderst du nicht deine Vorräte, sondern rufst im Volksblatt an und schon schwebt ein Weihnachtsengel herbei und zaubert ein wenig Weihnachtsglanz in die kümmerliche Hütte. Oder jemand wählt die Nummer und berichtet von der Familie X, bei der es Weihnachten eher traurig zugeht. Der Weihnachtsengel macht sich auf den Weg, falls angezeigt, sogar gleich in Begleitung eines Sozialarbeiters.
1. Polizeibeamter: Diese Idee stieß bei den Lesern auf große Resonanz und griff sofort. Nach dem aufrüttelnden Artikel gestern über Weihnachten und Christenliebe meldete sich sofort ein älteres Ehepaar beim Volksblatt für eine alleinstehende Frau mit drei Kindern.
3. Polizeibeamter: Herr Klingbeil unterbrach seine eigenen Weihnachtsvorbereitungen und suchte mit Frau Brand die Familie auf. Stell dir vor, auch die geschädigt von einem gewissen Herrn Schulz.
Er zeigt auf den 2. Polizisten.
Und der vereinzelte Herr da drüben unterbricht heute Abend seine Sause, mimt für die drei Rotznasen den diesjährigen Weihnachtsmann und verteilt die Gaben, die großzügigerweise das Volksblatt spendierte. Klasse Angelegenheit, was? Und für das nächste Jahr sorgen wir mit unserem Sparschwein vor.
Frau Kowalski betritt das Zimmer und steuert gleich auf Heidrun zu.
Frau Kowalski: Schwester Heidrun! Habe ich doch im Halbschlaf richtig gehört. Gottseidank! Wieder frisch auf den Beinen. Ich machte mir schon solche Gedanken und soviele Vorwürfe, dass sie sich wegen mir derartigen Schwierigkeiten aussetzen.
Heidrun: Sie brauchen sich überhaupt keine Vorwürfe machen, Frau Kowalski. Nicht sie, zwei Schreibtischtäter verursachten die Probleme.
Frau Kowalski: Genau das bemerkte Frau Brand auch, als sie mir Freitag das Geld brachte. Es tröstet wenig. Hätte ich bloß den Mund gehalten und sie nicht in ein derartiges Desaster gestürzt. Mein schlechtes Gewissen nagt unaufhörlich und schilt mich eine verantwortungslose Närrin.
Die Pflegerin nimmt die zerknirschte Frau in den Arm.
Heidrun: Machen sie mal einen Punkt, Frau Kowalski. Ich habe das kleine Abenteuer anstandslos überlebt. Zermürben sie sich nicht sinnlos ihren Kopf, bis wir hier alle in Trübsal verfallen. Ihre Wohnhöhle ist wieder eine Wohnung, in der man sich wohlfühlt. Genießen sie es einfach, nicht mehr ängstlich morgens aufzuwachen und vor der Not des Tages zu bibbern. Mitgefühl siegte über Arroganz, Verständnis über Ignoranz, Anteilnahme über Zynismus. Gegen das Gefühl, die eigene Wehrlosigkeit gegenüber der eiskalten Fresse eines Bürokraten zu überwinden, verblasst jeder Bluterguß. Schmälern sie nicht unseren Triumph mit dem unwichtigen Gestern. Vergangen! Vorbei! Heute feiern wir, Frau Kowalski, und wir haben allen Grund dazu.
Frau Kowalski: Nein, die gute Laune möchte ich ihnen nicht verderben. Ich bin ihnen und allen Anderen unendlich dankbar. Fast überwältigt mich der Segen, der mich plötzlich überflutet. Soviel Geld! Und in Zukunft erhalte ich jeden Tag eine Zeitung. Das Volksblatt überreichte mir zu Weihnachten ein Geschenkabonnement. Da kann ich wie früher jeden Morgen meine Zeitung lesen.
3. Polizeibeamter: Am besten in dem neuen Schaukelstuhl, Frau Kowalski, den ihnen mein junger Kollege zu Weihnachten schenken möchte.
Dabei deutet der 3. Polizeibeamte auf den Stuhl vor dem Fenster.
Frau Kowalski: Was – der ist für mich? Aber so etwas kann ich doch gar nicht annehmen. Bestimmt kostete er ein Vermögen.
3. Polizeibeamter: Ach, zieren sie sich nicht und setzen sie sich erstmal hinein! Nachher ist das Ding völlig unbequem?
Zögernd folgt Frau Kowalski der Aufforderung.
Frau Kowalski: Nein! Ein kuschliger Platz zum Verweilen!
3. Polizeibeamter: Na also! Sie könnten sich sogar für das Geschenk revanchieren, jetzt, wo durch Heizung, Strom und Gas ihnen nichts mehr abgeht. Laden sie den Lümmel heute abend zum Essen ein. Kaum zu glauben, aber der kann sogar kochen.
Verlegen senkt der 1. Polizist den Kopf und die Pflegerin sieht den 3. Polizisten fragend an.
Frau Kowalski: Ja, wenn er mit so einer alten Frau wie mir Heiligabend verbringen wollte? Ich würde mich freuen, zum Fest nicht alleine da zu hocken. Darüber würde ich mich mehr als freuen.
3. Polizeibeamter: Der Lauser will, nicht wahr!
Der 1. Polizeibeamte nickt immer noch verschämt zustimmend und der 3. Polizist raunt der zweifelnd dreinblickenden Pflegerin zu:
Heilig Abend ohne Familie verkraftet manch einer nicht und wir ziehen den Bettpisser dies Jahr nicht wieder sturzbesoffen aus einer Kneipe.
Beide grinsen übereinstimmend. Der 1. Polizist überhört geflissentlich diese Bemerkung, scheint aber erleichtert über die Einladung zu sein.
1. Polizeibeamter: Ich bereite heute abend für uns ein feines Festmahl und sie suchen derzeit ihre Fotos heraus. Die könnten wir uns später anschauen und gleich für Frau Brand die Fotografien vom Falkenseer Haus und Charlottenburger Atelier aussortieren, ja?
Frau Kowalski: Ein guter Vorschlag! Denken sie, Schwester Heidrun, die Frau Brand machte mal eine Reportage über Bürger dieses Bezirkes, die in der Nazizeit im Widerstand kämpften. Sie wunderte sich, weshalb ihr mein Name geläufig vorkam. Aus Falkensee zog nach dem Krieg ein Ehepaar Willy und Charlotte Otto her. Herr Otto erzählte ihr dazumal von einem Maler in der Schutzhaft, dem sie alle Finger brachen. Da die Menschenschinder jegliche Kontaktaufnahme der Gefangenen in der Einzelhaft verhinderten, kommunizierten sie über ein Abflussrohr und vertrauten sich gegenseitig ihre Personalien an, falls einer nicht lebend die Haft übersteht. Herr Otto kannte noch den Namen und gab ihn damals der Frau Brand an: Fritz Kowalski. Friedrichs Freunde nannten ihn immer Fritz. Der Willy Otto ist anerkanntes Opfer der Nationalsozialisten. Gestern kam Frau Brand vorbei und zeigte mir Herrn Ottos eidesstattliche Erklärung für Friedrich. Sie versprach mir, nicht eher zu ruhen, bis mein Fall neu aufgerollt ist. Warum lachen sie denn, Schwester Heidrun?
Heidrun: Es ist schon komisch, wie klein die Welt ist. Erzählen sie bloß keinem von unserem Gespräch. Nachher heißt es nämlich, ich hätte die Ottos beeinflusst.
Frau Kowalski: Wieso?
Heidrun: Beim Ehepaar Otto verkehre ich täglich. Frau Otto bedarf der Pflege seit circa zwei Jahren. Heute abend bin ich wieder bei ihnen. Da frage ich mal, was sie von einem Besuch ihrerseits halten. Die gastlichen alten Leute werden gleich empört fragen, warum ich sie nicht augenblicklich mitbrachte.
Frau Kowalski: Das wäre schön! Und ich kann mir sogar einen Blumenstrauß leisten und mitbringen. Das gehört sich einfach, wenn man eingeladen ist. Ich möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Heute hätte ich auch Kaffee zu bieten. Ach bitte, Schwester Heidrun, den lehnen sie mir nicht ab.
Heidrun: Nein, aber kochen tut ihn da der Herr mit den überschüssigen Kräften.
2. Polizeibeamter: Gerne, Karbolmäuschen!
Heidrun: Achtung! So etwas dürfen nur handverlesene Bullen zu mir sagen.
3. Polizeibeamter: Danke für das Kompliment! Ach, Krankenschwestern und Bullen sind doch eigentlich ein ideales Paar. Aber ich bin schon glücklich verheiratet.
Heidrun: Ich wüsste auch nicht, ob ich den Bouillongestank Tag und Nacht aushielte.
3. Polizeibeamter: Rote Henne!
Heidrun: Das macht zwei Mark pro Nase für das Schwein! So gefällt mir Mangel an Erziehung. Frau Kowalski, meine winzige Aufmerksamkeit zu Weihnachten versüßt ihnen vielleicht den bestellten Kaffee.
Damit holt Heidrun ein kleines in Geschenkpapier gewickeltes Päckchen und reicht es der alten Dame, die es auspackt.
Frau Kowalski: Das war doch nicht nötig, wo sie bereits soviel für mich taten. Marzipankartoffeln! Oh Schwester Heidrun, woher wussten denn sie, dass ich diese so liebe?
Heidrun: Freitag vormittag schilderten sie mir ihre Begeisterung über die Marzipankartoffeln in Tunis.
Frau Kowalski: Glatt vergessen! Strömt aber auch eine Menge auf mein graues Haupte ein. Ihr seid alle so lieb zu mir. Als kleines Kind dachte ich, der Weihnachtsmann käme mit dem Schlitten. Natürlich trug er einen langen Mantel mit wallendem Bart und eine rote Mütze auf dem weißen Haar. Der brachte mir mal eine Puppe mit, ein neues Kleid, einmal einen wunderschönen roten Wintermantel mit schwarzem Samtkragen, Schlittschuhe, Malbücher oder das Puppenhaus. Bereits Wochen vor Heiligabend raubte die Aufregung mir den Schlaf, mit welchem Geschenk er mich diesmal überrasche. Traditionell gab es jedes Jahr einen bunten Pappteller mit Äpfeln, Nüssen, Schokolade und das Allerbeste: Marzipankartoffeln. Die aß ich für mein Leben gern und bevor ich eins der Geschenke auswickelte, naschte ich stets zuerst eine dieser Köstlichkeiten. Und sogar in den kargen Kriegsjahren, die ich als Kind erlebte, zauberte der Weihnachtsmann Marzipankartoffeln auf meinen Weihnachtsteller. Dieses Jahr vermehrt sich sehr überraschend der Weihnachtsmann und trägt grüne Uniformen. Und das Christkind benutzt statt Schlitten eine kleine weiße Kastenente mit der Aufschrift: Sozialstation.
Heidrun: Nein, nein. Grüne Herren symbolisieren Ampelmännchen oder Weihnachtszwerge. Der Weihnachtsmann sieht schon so aus, wie sie es sich als Kind vorstellten. Zerstören sie sich nicht ihre kostbaren Kindheitserinnerungen.
1. Polizeibeamter: Zwerge? Erich, kostet das eine Mark?
Heidrun: Oder Ampelmännchen! Na gut, wenn ihr euch selber als Weihnachtsmänner definiert?
3. Polizeibeamter: Eigentlich ist diese Bemerkung schon eine Mark wert. Dummerweise entzieht sie sich durch die Doppelbödigkeit des Fassbaren.
Heidrun: Frau Kowalski! Bis der junge Mann vom Ernteeinsatz mit den Kaffeebohnen zurückkehrt........
Empört schreit der 2.Polizeibeamte aus der Küche ins Wohnzimmer herüber
2. Polizeibeamter: Soll ich den Kaffee filtern oder panschen?
Heidrun: setzen wir in aller Ruhe für die Krankenkasse das Schreiben auf, dass sie keine Hauskrankenpflege benötigen. Bei ihrer beneidenswerten Rüstigkeit brauchen sie mich wirklich nicht.
Frau Kowalski: Ach schade! An sie könnte ich mich gewöhnen. Tja! Was Recht ist, muss Recht bleiben. Doch vor der leidigen Pflicht genehmigen wir uns eine Leckerei, ja?
Frau Kowalski reißt die Tüte Marzipankartoffel auf und bietet den Anderen an, bevor sie sich selber eine nimmt, an ihr riecht und sie dann genießerisch in den Mund steckt.
Greift zu, Kinder! Mmmmh, die duftet wahrhaftig besser als die trockenen Kartoffeln der letzten Jahre. So riecht Weihnachten.
- Ende -

Frau Kowalski erhielt keine Wiedergutmachung, trotz der eidesstattlichen Erklärung.
Einige Wochen nach dem Vorfall wurde die gegenüberliegende Wohnung von Frau Kowalski frei, in die der eine Jungpolizist zog. Unter ihrem Einfluss veränderte er sich massiv und wurde entschieden selbstbewusster. Er bekam auch sein Alkoholproblem in den Griff. Sie erkannte sein Zeichentalent und förderte es. Neun Jahre lebten die Beiden Tür an Tür und als sie sehr hinfällig wurde, pflegte er sie derart aufopferungsvoll, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, dass es nicht ihr Sohn ist. Nach ihrem Tode erbte er die vier Bilder von Friedrich, die einen erheblichen Wert darstellten und die der Nachlassverwalter "übersah".
Schulz und Meyer wurden in eine andere Behörde strafversetzt.
Beim Pförtner ließ man Gnade walten.
Herr Klingbeil wurde Leiter des Sozialamtes und galt bis zu seiner Pensionierung als sehr engagiert.
Frau Brand blieb durch ihren verantwortungsvollen Journalismus eine Bereicherung.
Und Herr Salomon wurde der beliebteste Bürgermeister eines Berliner Stadtbezirkes und brauchte sich um seine Wiederwahl nie Gedanken machen.
Frau Becker machte später ausschließlich den bürokratischen Teil der Sozialstation. Die praktischen Einsätze organisierte und lenkte nun eine Pflegedienstleitung, eine Krankenschwester, die als "Schulschwester" ausgebildet war. Dem Pflegepersonal wurde sehr schnell klar, warum sie nicht lange an der Krankenpflegeschule unterrichtet hatte. Systematisch graulte sie mit teilweise üblen Schikanen nach dem Kirchenerlass alle Pflegekräfte hinaus, die nicht einer christlichen Kirche angehörten, darunter Heidrun Dreyer. Schnell stellte es sich bei dem verbleibenden Pflegepersonal heraus, dass katholisch sein allein nicht für die Pflege reichte. Frau Becker bedauerte sehr die Entwicklung in ihrer vormals so gut geführten Sozialstation. Sie blieb mit Heidrun Dreyer jahrelang im freundschaftlichen Kontakt.